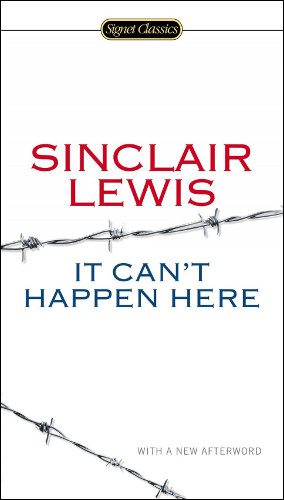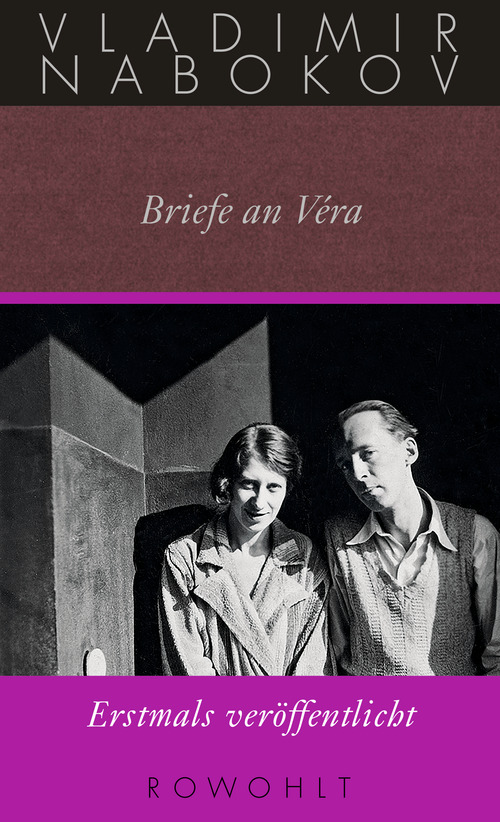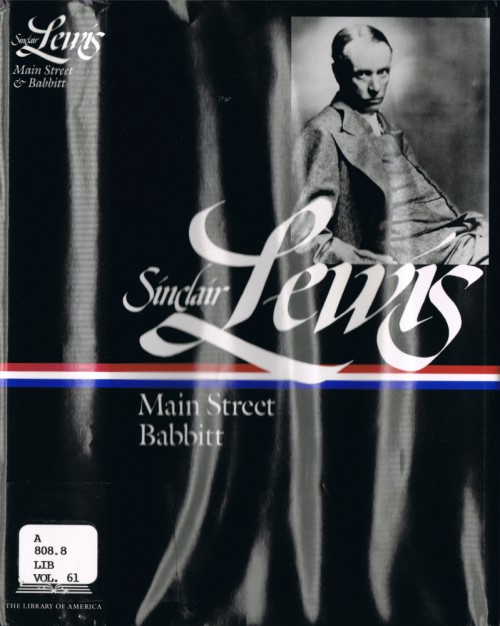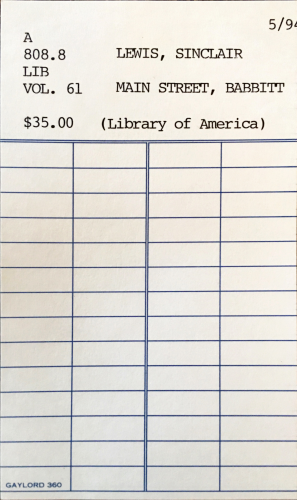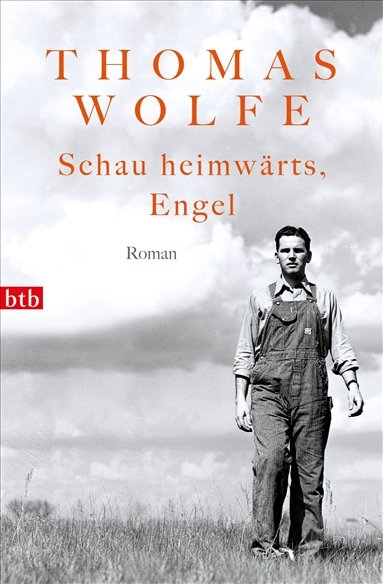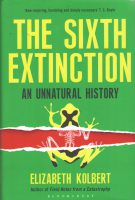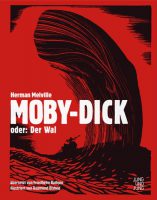Der Roman entstand und erschien 1935 und beschreibt einen faschistischen Staatsstreich in den USA nach dem Vorbild der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland. Der demokratische (im Sinne der US-amerikanischen Partei, nicht der Staatsform) Kandidat Berzelius Windrip gewinnt die Wahl 1935 mit einem populistischen Programm, das sich an Arme und Veteranen wendet und ihnen vergleichsweise goldene Zeiten verspricht. Nach seiner Inauguration Anfang 1936 hebelt er durch Notstandsgesetze den Kongress aus und zerschlägt die traditionellen US-Staaten durch das Einführen von willkürlichen Verwaltungsgrenzen und -strukturen, in denen seine Parteigänger als Funktionäre eingesetzt werden. Gestützt und geschützt wird dieser Prozess durch eine private Miliz, die Minute Men (M. M.), die faktisch die Polizeigewalt inne haben.
Protagonist des Romans ist Doremus Jessup, älterer Chefredakteur einer Tageszeitung einer Kleinstadt an der amerikanischen Ostküste. Sozial etabliert, verheiratet mit drei Kindern und einer Geliebten, nicht parteipolitisch gebunden, ist Jessup das Muster des liberalen nordamerikanischen Intellektuellen: klassisch gebildet, sich der sozialen Frage bewusst mit einer leichten Tendenz zum demokratischen Sozialismus, misstrauisch allen starken Ideologien der Zeit gegenüber – also letzten Endes ein idealisierter Selbstentwurf Lewis’. Im Gegensatz zu den meisten seiner Bekannten misstraut Jessup von Beginn an dem Kandidaten Windrip, hält sich aber zurück in dem Glauben, dass das alles vorübergehen wird.
Erst ein Gewaltverbrechen an einem Rabbi und einem Universitäts-Professor durch einen betrunkenen hohen Vertreter des neuen Staates, also ein Übergriff politischer Barbaren auf die gesellschaftliche Gruppe, der er sich selbst zuordnen, veranlasst ihn zu einem ersten offen kritischen Kommentar in seiner Zeitung. Die Reaktion des neuen Staates lässt nicht lange auf sich warten: Jessup wird verhaftet und einem Richter vorgeführt, der sich aber überraschend milde zeigt, indem er Jessup dazu zu überreden versucht, sich mit dem neuen Staat zu arrangieren. Um seinem Vorschlag Nachdruck zu verleihen, lässt er Jessups Schwiegersohn umgehend standrechtlich erschießen und setzt ihm in seiner zeitung einen staatlichen Aufpasser vor die Nase, den er vorgeblich als seinen Nachfolger einarbeiten soll.
Jessup betreibt daraufhin erfolgreich seine Pensionierung und beginnt zugleich, sich dem politischen Widerstand gegen die Diktatur zu verbinden. Er betreibt im Neuen Untergrund eine geheime Presse, die Flugblätter mit Nachrichten und Gerüchten herstellt und verteilt. Insgesamt geht man in der kleinen lokalen Widerstandsgruppe sehr lax mit der Geheimhaltung um, so dass es kein Wunder ist, dass Jessup nach nur wenigen Monaten in einem Konzentrationslager landet. Nach nur fünf Monaten und nicht der grausamsten aller denkbaren Behandlungen wird er durch Initiative seiner Geliebten befreit und nach Kanada gebracht, wo er eine Stelle in der US-amerikanischen Exil-Regierung findet. Der Roman hat ein offenes Ende, das die ersten Erfolge des politischen und militärischen Widerstandes gegen den neuen Staat beschreibt, an dessen Spitze nach mehrfachen Staatsstreichen inzwischen ein Militär steht. Der letzte Satz feiert den ewigen Jessup, der nun bei aller ironischen Distanz und wohl in Ermangelung eines Besseren dann doch zum idealen Vorkämpfer der guten Sache gemacht werden muss.
Der Roman war ein sofortiger großer kommerzieller Erfolg. Man plante sogar eine Hollywood-Verfilmung, die aber trotz weitreichenden Vorbereitungen nie zustande kam– man darf staatliche Rücksichtnahme auf die Beziehungen zum Deutschen Reich als Ursache dafür annehmen. Stattdessen gab es eine sehr erfolgreiche Umsetzung für die Bühne. Es ist leicht zu erkennen, dass nicht nur Sinclair das Szenarium des Romans für eine nicht ganz und gar abwegige utopische Alternative zur US-amerikanischen Geschichte hielt.
Angeregt zu dem Buch wurde Lewis durch die Reportagen seiner Ehefrau Dorothy Thompson, die von 1924 bis 1934 in Berlin gelebt und den Aufstieg der Nationalsozialsten zur Macht journalistisch eng begleitet hatte. Aus ihrer Kenntnis und der weiterer Bekannter, die in dieser Zeit in Europa gelebt hatten, bezog Lewis im Wesentlichen die Vorbilder für die faschistische Machtübernahme in seinem Roman. Streng genommen gehört das Buch nicht in das Genre der Alternativen Geschichte, da es in der unmittelbaren Zukunft spielt, also eine Warnutopie darstellt, wird aber natürlich heute so gelesen. Es hat durch den aktuellen weltweiten Rechtspopulismus, aber auch durch den in den USA gezogenen durchaus provokanten Vergleich des Aufstiegs Donald Trumps mit dem von Lewis’ Diktator Berzelius Windrip überraschend an Popularität gewonnen.
Sinclair Lewis: It Can’t Happen Here. New York: Penguin Random House, 2014. Kindle-Edition, 195 Seiten. 5,49 €.