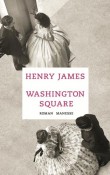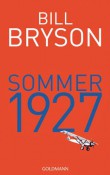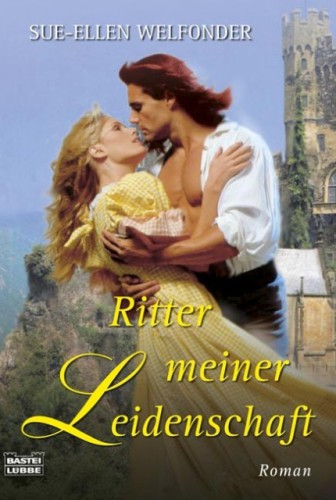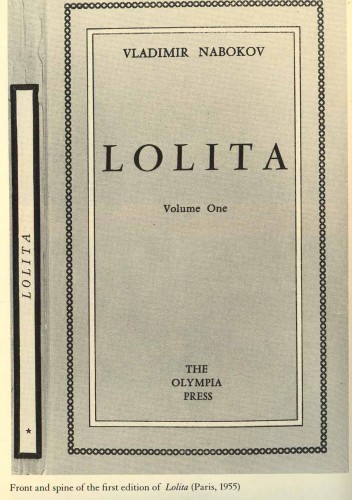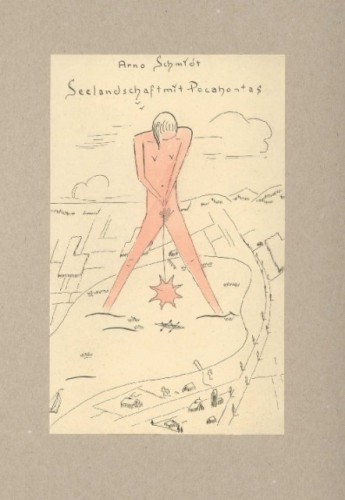Henry James hat eine bedeutende Anzahl von Erzählungen geschrieben, die zusammen an die 4.700 Seiten füllen, was gut 40 % seines erzählerischen Gesamtwerks entspricht. Das Phänomen, dass die Erzählung in ihren verschiedenen kürzeren Formen während des 20. Jahrhunderts gegenüber dem Roman langsam aber sicher an Boden verloren hat und heute jede Erzählung, die es – unter welchen setzerischen Bedingungen auch immer – auf 150 Seiten oder mehr bringt, vom Vertrieb sofort als Roman ausgeschrien wird, ist hier schon an einigen Stellen thematisiert worden. Für James boten kürzere Erzählungen einerseits die Möglichkeit eines relativ stetigen und sicheren literarischen Einkommens, andererseits lieferten sie ihm ein disziplinierendes Gerüst, denn sie entstanden in der Regel unter dem Druck konkreter Erscheinungstermine.
Henry James hat eine bedeutende Anzahl von Erzählungen geschrieben, die zusammen an die 4.700 Seiten füllen, was gut 40 % seines erzählerischen Gesamtwerks entspricht. Das Phänomen, dass die Erzählung in ihren verschiedenen kürzeren Formen während des 20. Jahrhunderts gegenüber dem Roman langsam aber sicher an Boden verloren hat und heute jede Erzählung, die es – unter welchen setzerischen Bedingungen auch immer – auf 150 Seiten oder mehr bringt, vom Vertrieb sofort als Roman ausgeschrien wird, ist hier schon an einigen Stellen thematisiert worden. Für James boten kürzere Erzählungen einerseits die Möglichkeit eines relativ stetigen und sicheren literarischen Einkommens, andererseits lieferten sie ihm ein disziplinierendes Gerüst, denn sie entstanden in der Regel unter dem Druck konkreter Erscheinungstermine.
Manesse schöpft schon seit einigen Jahren aus dem reichen Fundus der Jamesschen Erzählungen und bringt immer wieder Sammlungen mit bislang unübersetzten Stücken heraus. Diesmal hat man mit Friedhelm Rathjen einen Übersetzer gefunden, dem es gelingt, die von James mit Sorgfalt ausdifferenzierten unterschiedlichen Ton- und Stillagen der einzelnen Erzähler auch im Deutschen herauszuarbeiten. Der vorgelegte Band ist eine hübsche Gelegenheit, Henry James als Erzähler kennenzulernen. Die sechs versammelten Erzählungen sind:
Louisa Pallandt (1888)
Der Erzähler ist ein alter, amerikanischer Junggeselle, der in Bad Homburg beim Warten auf die Ankunft seines jungen Neffen, den er mit den Sehenswürdigkeiten Europas vertraut machen soll, seine alte Liebe Louisa Pallandt und deren Tochter Linda wiedertrifft. Louisa hat ihn einst für einen reicheren Ehekandidaten sitzen lassen, der sich allerdings als Bankrotteur erwies, bald verstorben ist und Louisa und die gemeinsame Tochter in relativer Armut zurückgelassen hat. Louisa führte seitdem ein unruhiges Wanderleben in Europa, das im 19. Jahrhundert zahlreichen US-Amerikanern ein preiswerteres Leben ermöglichte. Der Erzähler begegnet seiner alten Liebe mit einiger Reserviertheit, doch als schließlich sein Neffe Archie zu der Gruppe stößt, geschieht das stets Unvermeidliche, wenn attraktive junge Leute aufeinandertreffen. Doch wird das junge Glück von der plötzlichen Abreise der Damen unerwartet unterbrochen.
Erst Wochen später teilt Linda Archie in einem Brief mit, dass sie sich inzwischen mit ihrer Mutter am Lago Maggiore aufhält. Von Archies Verliebtheit getrieben, reisen die Herren ebenfalls dorthin, doch gleich bei der ersten Begegnung zeichnet Louisa dem Erzähler ein recht dunkles Bild von ihrer Tochter. Diese sei ein kaltes, herzloses Wesen, von ihr selbst dazu erzogen, um jeden Preis eine hohe gesellschaftliche Stellung und Reichtum zu erlangen. Louisa eröffne ihm dies, um Buße zu tun für ihre eigene ehemalige Grausamkeit, und werde deshalb auch dafür sorgen, dass Archie nicht in den Fängen dieser Sirene ende. Der Erzähler bleibt ebenso verstört zurück wie der Leser, doch sind in dieser ersten Erzählung bereits die zentralen Themen der Sammlung vorgegeben: Liebe, romantische Leidenschaft und bürgerliche Ehe sowie das für James überhaupt wichtige Motiv der Tradierung und Widerspiegelung sozialer und psychologischer Muster in unterschiedlichen Beziehungen beziehungsweise Generationen.
Der Beldonald-Holbein (1901)
ist die einzige Erzählung dieser Sammlung, in der es nicht in irgendeiner Weise um die Schwierigkeiten der Vermittlung von romantischer Liebe und bürgerlichen Vorstellungen von Sitte und Anstand geht. Erzählt wird vielmehr vom Auftauchen einer älteren Dame mit einem Holbeinschen Charaktergesicht in der Londoner Gesellschaft. Sie soll eigentlich als hässliche Gegenfolie der um ihren Status als Schönheit besorgten Lady Beldonald dienen und ist zu diesem Zweck extra aus Amerika eingeführt worden, wird aber bei ihrem ersten Besuch im Atelier des Malers, der der Erzähler dieser Anekdote ist, als Modell entdeckt. Die Lady, die eigentlich portraitiert werden sollte, verhindert zwar, dass ein Bild ihrer Gefährtin entsteht, erträgt aber ihren Ruhm als Holbein für eine Weile, bevor sie sie zurück nach Amerika verfrachtet. Dort stirbt die vom Ruhm Abgeschnittene nach nur kurzer Zeit an Vereinsamung. Diese späte Erzählung, die sich über den seltsam schiefen Gegensatz von Oberflächlichkeit bei gleichzeitiger hoher Kultiviertheit in London einerseits und der US-amerikanischen Ignoranz gegenüber der europäischen Kulturtradition andererseits lustig macht, ist ein mildes satirisches Kabinettstück, hängt mit den übrigen Erzählungen des Bandes aber nur lose zusammen.
Das Tagebuch eines Mannes von fünfzig Jahren (1879)
erzählt die Geschichte eines älteren englischen Generals, der nach vielen Jahren den Ort seiner ersten großen Liebe wieder aufsucht: Florenz. Dort trifft er auf einen jungen Landsmann, der sich zu der Tochter der ehemaligen Angebeteten des Generals in einer nahezu identischen Beziehung befindet wie der General einstmals zur Mutter. Da der General der Auffassung ist, die Mutter habe ihm seinerzeit übel mitgespielt und sei überhaupt eine unmoralische Kokotte gewesen, macht er es sich zur Aufgabe, den jungen Mann vor demselben Schicksal zu bewahren. Am Ende erweist sich wieder einmal, dass es immer einen Narren mehr gibt, als jeder glaubt.
Der spezielle Fall (1898)
erzählt die Geschichte zweier Affären bzw. ihrer Folgen: Zum einen hatte der junge Barton Reeve eine Affäre mit einer verheirateten Frau, Mrs. Kate Despard, Gattin eines britischen Colonels, von der er nun erwartet, sich scheiden zu lassen, was Mrs. Despard aber trotz ihrer Abneigung gegenüber ihrem Ehemann nicht willig zu tun ist. Zum anderen hatte der mit Barton befreundete Philip Mackern eine Affäre mit der bereits anderweitig verlobten jungen Freundin Mrs. Despards, Margaret Hamer, die sich weigert, sich von ihrem in Indien als Offizier stationierten Verlobten loszusagen. Beide Männer versuchen über die jeweils andere Frau Druck auf ihre Angehimmelte auszuüben. Wie alles tatsächlich ausgeht, interessiert James schon gar nicht mehr; ihm genügt es, die Überschreitungen der gesellschaftlichen Etikette und die daraus resultierenden Hilflosigkeiten der Beteiligten zu schildern, die sich aus der gesellschaftlich nicht sanktionierten Intimität der Affären ergeben.
Die Eindrücke einer Kusine (1884)
ist ebenfalls als Tagebuch geschrieben: Die alte Jungfer Catherine Condit begleitet ihre reiche Kusine Eunice aus Europa nach New York, obwohl es ihr dort gar nicht behagt. Eunice ist noch minderjährig, erwartet aber die Übertragung eines erheblichen Vermögens, das lange Jahre von einem Mr. Caliph als Treuhänder verwaltet wurde. Während sich die Damen in New York etwas langweilen, beginnt der Halbbruder von Mr. Caliph, Adrian Frank, Eunice den Hof zu machen, während Mr. Caliph vorgibt, dass es bei der Übertragung des Vermögens noch einige Schwierigkeiten zu bewältigen gibt. Nach einigem Hin und Her stellt sich natürlich heraus, dass Mr. Caliph Eunices Vermögen veruntreut hat und nun versucht, ihr in Form des Vermögens seines Halbbruders einen Ausgleich zu verschaffen. Eunice aber will nicht Adrian heiraten, sondern ist verliebt in Mr.Caliph, während sich Adrian mittlerweile in Catherine verliebt hat. Auch die Auflösung dieser Verwicklungen kann man sich selbst zurechtlegen, so wie das meiste andere an dieser Erzählung, die für ihren Inhalt zweifellos viel zu lang geraten ist.
Die entscheidende Bedingung (1900)
ist das Schmuckstück dieser Sammlung. Erzählt wird die Geschichte zweier Engländer, Bertram Braddle und Henry Chilver, die bei ihrer Rückreise aus den USA, die sie hauptsächlich bereist haben, um die vielbesprochenen amerikanischen Frauen kennenzulernen, Mrs. Damerel begegnen und sich beide in sie verlieben. Bertram als der ältere und situiertere von beiden ist derjenige, der so etwas wie eine Beziehung mit ihr beginnt, sich nach einiger Zeit in England auch mit ihr verlobt, aber von einem nagenden Zweifel beherrscht wird, ob Mrs. Damerel nicht eine dunkle Vergangenheit habe. Dieser Zweifel wird noch dadurch geschürt, dass ihm seine Verlobte sagt, sie habe ihm durchaus etwas zu gestehen, werde es ihm aber erst sechs Monate nach der Hochzeit verraten, wenn er es dann noch wissen wolle. Anstatt seine Geliebte zu heiraten, verschwindet Bertram wieder in die USA, um dort – vergeblich – Nachforschungen über sie anzustellen.
Seine Abwesenheit nutzt Henry dazu aus, Mrs. Damerel den Hof zu machen, die denn auch die Verlobung mit dem abwesenden Bertram löst und Henry heiratet. Sieben Monate nach der Hochzeit treffen die beiden Freunde einander wieder in London, und Bertram muss zu seinem innerlichen Entsetzen erfahren, dass Henry seine Frau nicht nur unter derselben Bedingung geheiratet hat, sondern von sich aus die Schweigefrist um weitere sechs Monate verlängert hat. Bertram bricht daraufhin den Kontakt zum Ehepaar wieder ab, taucht aber weitere acht Monate später bei Mrs. Chilver auf, um zu versuchen, von ihr das dunkle Geheimnis ihres Vorlebens zu erfahren. Der Schluss dieser Erzählung soll hier selbstverständlich nicht verraten werden.
James muss es großes Vergnügen gemacht haben, die einander umkreisenden Gespräche dieser beiden Gentlemen niederzuschreiben, denen es – und wenn etwas sie auch noch so plagt – niemals erlaubt ist, eine unverstellte Äußerung zu tun, sondern die stets mit großem Geschick um den heißen Brei herumreden. Selbst an der Stelle, wo sie allen Grund hätten, einander zu hassen oder zu verachten, bewahren sie eine bewundernswerte Contenance und soziale Distanz. Und natürlich erweist sich ihnen am Ende die Amerikanerin in jeglicher Hinsicht als überlegen. Wer James kennen und schätzen lernen möchte, beginne mit dieser Erzählung!
Henry James: Das Tagebuch eines Mannes von fünfzig Jahren. Aus dem Englischen übersetzt von Friedhelm Rathjen. Zürich: Manesse, 2015. Leinenband mit rotem Farbschnitt, Lesebändchen, 406 Seiten. 26,95 €.