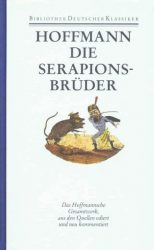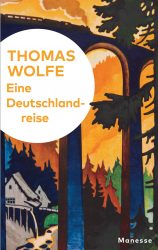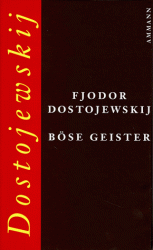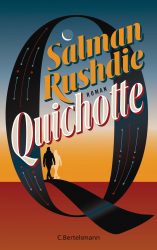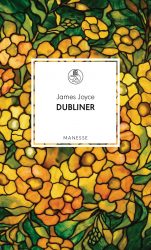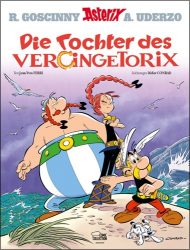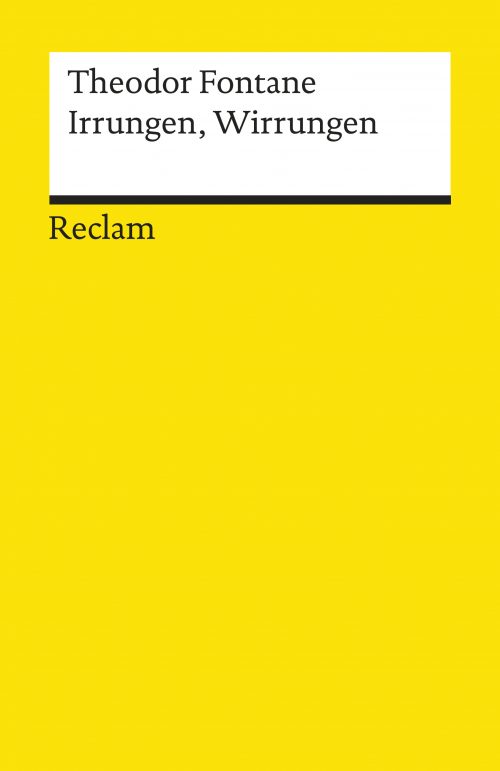Die Freunde waren darin einig, daß nichts so toll und wunderlich zu ersinnen, als was sich von selbst im Leben darbiete.
Der dritte Band der Serapionsbrüder erschien im September 1820, ein Jahr nach dem zweiten.* Wie um diese Zeitspanne zu thematisieren, lässt Hoffmann den fünften Abschnitt mit dem Hinweis beginnen, dass mehrere Monate seit dem letzten Treffen der Freunde vergangen seien. Theodor war in der Zwischenzeit ernstlich erkrankt und von Lothar gepflegt worden; die andere inzwischen vier Serapionsbrüder waren aus unterschiedlichen Gründen von Berlin abwesend. Nun bietet die Rückkehr Ottmars den Anlass, die Gesundung Theodors zu feiern und einen weiteren literarischen Abend miteinander zu verbringen. Die Rückkehr Cyprians wird vorerst aufgespart, um in die Schauergeschichte Der unheimlich Gast einen kleinen, ironisierenden Knalleffekt einbauen zu können.
Das Gespräch der drei Freunde, diesmal unter freiem Himmel in einer Gartengaststätte, knüpft an Der Kampf der Sänger aus dem vorhergehenden Band an: Lothar habe sich, durch diese Geschichte angeregt, nun selbst mit alten Chroniken befasst und dort vorzüglich auf das Treiben des Teufels – der ja auch im Kampf der Sänger eine nicht unwichtige Rolle spielt – Acht gegeben. Er belegt dies auch sogleich durch die eher anekdotische Erzählung [Aus dem Leben eines bekannten Mannes] (Lo)**, die von einer unglücklichen Geburt und der anschließenden Verleumdung der Hebamme als Hexe und ihrer Verbrennung berichtet. Nach einem kurzen Exkurs über das reale Leid der Hexenprozesse und das Spiel der romantischen Phantasie mit solchen Motiven des Unheimlichen, folgen zwei Geister- bzw. Schauergeschichten:
- Die Brautwahl (Lo) erzählt in humoristischer und stark ironischer Weise eine verwickelte Liebeskomödie im zeitgenössischen Berlin. Im Zentrum steht der Goldschmied Leonhard, der seinem Schützling Edmund, einem jungen Maler, mit zauberischen Mitteln zu seiner Angebeteten Albertine verhilft, die aber durch ihren Vater schon dem Geheimen Kanzlei-Sekretät Tusmann versprochen ist. Zur Auflösung stiehlt Hoffmann aus Shakespeares Kaufmann von Venedig die Kästchenwahl; er erfindet sogar einen sonst gänzlich unnützen dritten Bewerber um die Gunst Albertines hinzu, um das Motiv vollständig kopieren zu können. Hübsch ist dann auch, dass Hoffmann bei aller Zitierung der Shakespeareschen Komödien seinen Lesern ein Komödienende schließlich verweigert. Stil und Ton der Erzählung dürften später ein wichtiges Vorbild für Bulgakows Der Meister und Margarita geliefert haben.
- Der unheimliche Gast (Ot) ist eine schauerliche Liebesgeschichte, in der ein Graf in der Familie eines Obristen auftaucht – der Obrist selbst ist dem Grafen durch frühere Gefälligkeiten verpflichtet – und dort durch magnetisch-hypnotischem Einfluss die Gefühle einiger junger Leute durcheinanderbringt. Auch hier versucht Hoffmann, wie oben bereits angedeutet, die schlimmsten Klischees des Genres zu ironisieren, was aber nicht so ganz gelingt. Die literarischen Freunde stellen denn auch fest, dass derlei Figuren wie der fremde Graf schon Überhand genommen haben und man sie leid geworden ist.
Auch der sechste Abschnitt hat als Ort die Gartenwirtschaft; nun sind wieder alle sechs Serapionsbrüder versammelt: Die Rückkehr Sylvesters nach Berlin ist durch die erfolgreiche Uraufführung eines Theaterstücks aus seiner Feder veranlasst. Der Abschnitt beginnt denn auch mit einem Gespräch über die Nöte der Dramatiker, die ihre Stücke an Regisseur und Schauspieler ausliefern müssen. Den Band beschließen drei Erzählungen:
- Das Fräulerin von Scuderi (Sy) ist eine lange Erzählung, die als erste Kriminalerzählung überhaupt angesehen wird. Auch in diesem Fall ist die ursprüngliche Quelle die Wagenseilsche Chronik – die schon Pate für den Kampf der Sänger gestanden hatte –, die von einer Mord- und Diebesserie im Frankreich Ludwig XIV. berichtet. In Mittelpunkt steht das titelgebende, alte Fräulein von Scuderi, das am Hofe verkehrt und auf merkwürdige Weise in die Verbrechensserie hineingezogen wird. Der Leser darf nach modernen Maßstäben keine zu streng gearbeitete Kriminalhandlung erwarten, aber die eigentliche Spannung des Stücks wird schon aus der falschen Beschuldigung eines Verdächtigen und dem endlichen Nachweis seiner Unschuld gezogen. Das Stück ist aber erzählerisch noch weit von Edgar Allan Poes The Murders in the Rue Morgue, also der Erfindung des analytischen Detektivs entfernt.
- Spieler-Glück (Th) ist eine etwas dünn geratene, mehrfach verschachtelte Erzählung über Kartenspieler, die alle von einer unglaublichen Glückssträhne heimgesucht und ins oder wenigstens beinahe ins Verderben gestürzt werden. Da es Hoffmann nicht wirklich gelingt, den psychologischen Typus des Spielers zu erfassen, bleiben die Protagonisten alle etwas vage und schwankend. Hoffmann bemerkte schon, dass in der Spielsucht ein Motiv steckt, dass dem Unheimlichen verbunden ist, aber die Erzählung gelingt letztlich nicht.
- Den Abschluss bildet die kurze humoristisch-musikalischen Anekdote [Der Baron von B.] (Cy), in der ein reicher Musikkenner und eingebildeter Geigenvirtuose eine große Rolle im Berliner Musikleben spielt.
E. T. A. Hoffmann: Die Serapionsbrüder. Sämtliche Werke 4. Hg. v. Wulf Segebrecht. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag, 2001. Leinen, Fadenheftung, zwei Lesebändchen, 1679 Seiten. Diese Ausgabe ist derzeit nur als Taschenbuch lieferbar.
* – Grundsätzliches zu Die Serapionsbrüder findet man in der Besprechung des ersten Bandes.
** – Titel in eckigen Klammern tauchen nicht im Original auf; die Kürzel in Klammern hinter den Titeln zeigen an, welcher der Serapionsbrüder die Erzählung vorträgt.