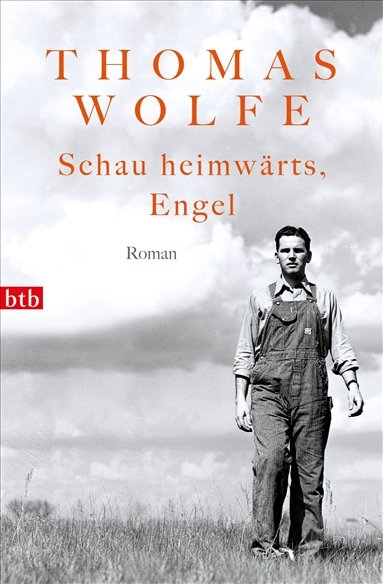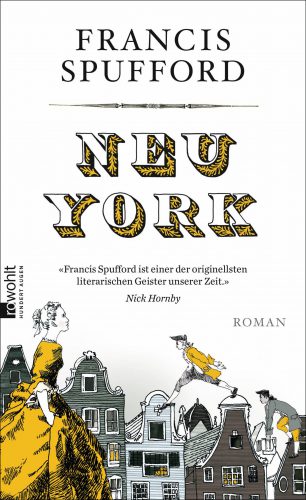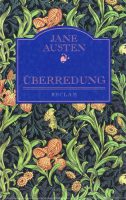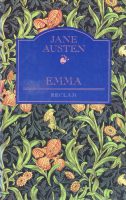O Gott! Ich werde das nie vergessen, dachte er.
Der Erstlingsroman Thomas Wolfes, 1929 erschienen, ist für heutige Leser in der Hauptsache Zeitzeugnis, zugleich aber auch Dokument für ein überbordenes Erzähltalent, das sich am Stoff des eigenen Lebens abarbeitet. Wolfes Manuskripte wurden von seinem Lektor auf ein wenigstens einigermaßen marktgerechtes Maß heruntergekürzt und so überhaupt erst für einen Verlag akzeptabel. Aber auch nach dieser Behandlung merkt man dem Buch immer noch an, dass Wolfe einer jener Erzähler ist, denen Alles zum literarischen Stoff werden kann und die im Grunde keinerlei Rücksicht auf sich selbst, ihren Stoff oder die Leser zu nehmen verstehen. Es ist daher kein Wunder, dass man in Wolfes Nachlass tausende und abertausende Manuskriptseiten gefunden hat, aus denen die veröffentlichten Bücher quasi nur eine mehr oder weniger willkürliche Auswahl darstellen.
Der Roman erzählt in seinen beiden Hauptteilen die Geschichte Eugene Gants, geboren im Jahr 1900 in einer kleinen Stadt in den Bergen North Carolinas, von seinem 12. bis zu seinem 19. Lebensjahr. Vorgeschaltet ist die Geschichte seines Vaters Oliver Gant, im Roman in der Regel nur mit seinem Nachnamen benannt, eines jungen Mannes, der aufgrund der Inspiration durch einen steinernen Engel den Beruf des Steinmetzen erlernt, eine erste Ehe hinter sich gebracht hat und nach deren tragischem Ende in den Alkoholismus abgerutscht ist. Gant findet sich nach einer Periode der Wanderschaft im kleinen Bergstädtchen Altamont wieder, in dem er zu seiner Überraschung eine weitere Frau findet, die ihn heiraten will: Eliza ist besessen von der Vorstellung, Wohlstand durch den Besitz von Liegenschaften zu erwerben, und heiratet ausgerechnet Gant, dem aller Immobilienbesitz zuwider ist. Das Ehepaar bekommt sieben oder acht Kinder (ich gebe zu, an irgendeiner Stelle die Übersicht verloren zu haben), von denen immerhin sechs das Erwachsenenalter erreichen. Eugene ist der Jüngste und wohl zugleich der Begabteste der Geschwister.
Während Gant auch weiterhin mit Phasen der Alkoholsucht zu kämpfen hat, eröffnet Eliza eine Pension, mit der sie wesentlich zum Unterhalt der Familie beiträgt. Wie schon gesagt, setzt die eigentliche Erzählung von Eugenes Leben erst nach knapp 200 Seiten ein: Seine Schulzeit wird ausführlich dargestellt, seine Pubertät, das Erwachen seiner Sexualität, aber auch die weiteren Schicksale seiner weitgehend dysfunktionalen Familie sind Thema des Romans. Eugene erhält eine vergleichsweise gute Ausbildung, da er aufgrund seiner Begabung die erste und einzige Privatschule Altamonts besuchen darf. Auf diese Weise mehr schlecht als recht vorbereitet, besucht er mit nur 16 Jahren die Universität und tut sich auch hier akademisch hervor. All das entfernt ihn einerseits immer weiter von seiner Familie, mit der er aber andererseits emotional in Hass und Liebe eng verbunden bleibt. So ist etwa die Beschreibung des Sterbens seines Bruders Ben eine der beeindruckendsten Passagen des gesamten Buchs. Ohne dass der Roman zu einem wirklichen Abschluss gelangen könnte, endet das Buch mit dem erfolgreichen akademischen Abschluss Eugenes und seinem Entschluss, entgegen dem Wunsch seiner Mutter nicht bei einer der lokalen Zeitungen anzufangen, sondern eine akademische Karriere anzustreben.
Das Buch ist formal aufgrund der oben bereits erwähnten Neigung Wolfes zu überschwänglichem Erzählen notwendig anekdotisch geblieben; aber nicht nur stofflich, sondern auch stilistisch bietet das Buch eine erstaunliche Breite zwischen Passagen voller Lyrismen bis hin zu deutlich an Joyce’ früher Prosa geschulten, minutiösen Miniaturen sozialer Kommunikation. An manchen Stellen gerät der Text auch einfach in den Schwulst eines sich an der eigenen Sprache berauschenden Schreiberlings:
Und Eugene beobachtete den langsamen Wechsel der Jahreszeiten; er sah der stolzen Prozession der Monate zu; er sah, wie das Sommerlicht sich wie ein Strom ins Dunkle fraß; er sah den erneuten Triumph der Finsternis und wie die minutengesättigten Tage wie Fliegen heimwärts summten in den Tod.
Das geht wahrscheinlich auch eine Nummer kleiner, ohne das aufzugeben, was gemeint ist.
Sie hatten niemals miteinander geredet. Ihre Blicke begegneten sich niemals – eine große Scham, die Scham zwischen Vater und Sohn, jenes Geheimnis, das tiefer als Mutterschaft und als das Leben selbst hinabreicht, jene geheimnisvolle Scham, die den Männern die Lippen versiegelt und in ihren Herzen wohnt, hatte sie zum Verstummen gebracht.
Wolfe wenigstens scheint diese ihn verstummende Scham erfolgreich überwunden zu haben. Nun gut.
Das Buch ist ohne Frage das, was man einen großen Wurf nennt. Wolfes emotionales Erzählen, seine Leidenschaft für den Stoff und seine Hassliebe zu den Figuren, aber auch die Schonungslosigkeit seinem Protagonisten gegenüber erzeugen einen Eindruck von Wahrhaftigkeit, dem sich der Leser nur schwer entziehen kann. Die neue Übersetzung von Irma Wehrli bietet im Gegensatz zur älteren von Hans Schiebelhuth einen sprachlich gut ausdifferenzierten deutschen Text, der der stilistischen Breite Wolfes erstmals gerecht zu werden scheint. Die Ausgabe ist durch Endnoten ausführlich kommentiert, die man, je nach eigener Vorbildung und -belastung mehr oder weniger nützlich finden wird. Die Behauptung des Nachworts, es seien „die Finessen der Intertextualität […] samt und sonders identifiziert“ worden, bliebe zwar kritisch zu prüfen, aber es ist schon eine erstaunliche Anzahl von literarischen Anspielungen festgemacht worden.
Eine intensive Lektüre, nicht ohne Schwächen, aber eben auch mit weiten Teilen, die immer noch gegen jede Kritik bestehen.
Thomas Wolfe: Schau heimwärts, Engel. Eine Geschichte vom begrabenen Leben. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Irma Wehrli. btb 74255. München: Random House, 32011. Broschur, 785 Seiten. 14,99 €.