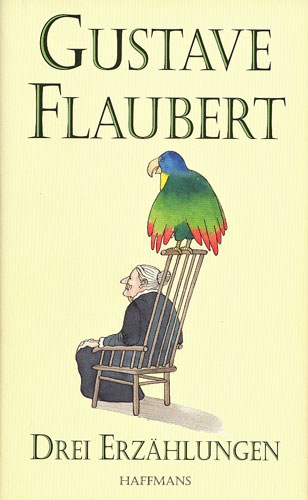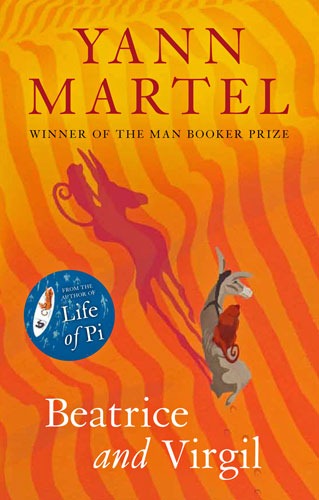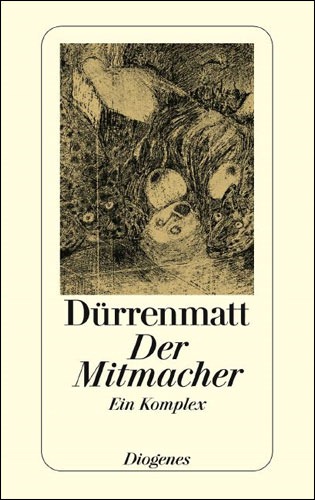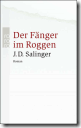Ausgelöst durch die Lektüre von Yann Martels Beatrice and Virgil habe ich mir noch einmal Flauberts Drei Erzählungen aus dem Schrank genommen, diesmal in der relativ neuen Übersetzung des Haffmans-Verlages, Gott habe ihn selig. Die drei Erzählungen repräsentieren jeweils einen Aspekt von Flauberts Romanschaffen: Ein schlichtes Gemüt seine realistischen Romane, in Die Legende von Saint Julien dem Gastfreundlichen spiegelt sich Die Versuchung des heiligen Antonius wider und Herodias schließlich ist ein Gegenstück zu Salambo, das ich auch wieder einmal lesen müsste.
Ein schlichtes Gemüt ist eine meisterhafte Erzählung, die auf weniger als 50 Seiten ein ganzes Leben umfasst: Félicité wird Hausangestellte bei der verwitweten Madame Aubain, nachdem sie wegen einer unglücklichen Liebesgeschichte von daheim fortgelaufen ist. Sie geht ganz und gar im Dienst für die Familie ihrer Herrin auf; einzig ihr Neffe Victor liegt ihr noch am Herzen, aber der stirbt jung als Seemann auf einer Fahrt nach Amerika. Tiefer jedoch trifft sie der Tod von Virginie, der Tochter des Hauses, die als Klosterschülerin an einer Lungenentzündung stirbt; Félicité beginnt einen heimlichen Totenkult um die Verstorbene. Doch ihre Liebe erfüllt sich schließlich, als sie von ihrer Herrin einen Papagei geschenkt bekommt, den diese von einer Nachbarin erhalten hatte. Loulou bleibt Félicité auch nach seinem Tod treu, nachdem sie ihn hat ausstopfen lassen. Mehr und mehr gerät er ihr zu einer Personifizierung des Heiligen Geistes, ja es gelingt ihr schließlich, ihn auf einem von ihr geschmückten Fronleichnamsaltar zu platzieren und ihn auf diese Weise mit Zustimmung des Pfarrers ganz und gar zu einer religiösen Ikone zu machen.
Es ist erstaunlich, mit welcher Ruhe und erzählerischen Ökonomie Flaubert auf den wenigen Seiten der Erzählung ein ganzes Leben umspannt. Jegliche Sentimentalität ist dem Erzähler fremd; er bleibt auch hier ein Gott hinter den Kulissen:
Der Künstler muß in seinem Werk wie Gott in der Schöpfung sein, unsichtbar und allmächtig; man soll ihn überall spüren, ihn aber nirgends sehen.
an Mlle Leroyer de Chantepie, 18.3.1857
Die Legende von Saint Julien dem Gastfreundlichen ist inhaltlich eine traditionelle Heiligenlegende, die angeblich durch die Darstellung der Legende in einem Kirchenfenster von Rouen inspiriert wurde. Julien wird unter Prophezeiungen geboren: Während der Schwangerschaft wird seiner Mutter seine Bestimmung zum Heiligen vorausgesagt, dem Vater am Tag der Geburt seine Karriere als großer Kriegsmann und Angehöriger einer kaiserlichen Familie. Julien wächst auf als ein grausames Kind, das aus Lust Tiere tötet, bald der Leidenschaft der Jagd verfällt und von dieser Besessenheit schließlich durch ein Wunder erlöst wird: Es stellen sich ihm im Wald eine unermessliche Anzahl von Tieren, die er alle tötet, um am Ende vom letzten Hirschen verflucht zu werden, er werde seine beiden Eltern ermorden. Von dieser Prophezeiung verschreckt und im Glauben tatsächlich seine Mutter aus Versehen getötet zu haben, flieht Julien, wird wie vorausgesagt ein gesuchter Krieger und heiratet schließlich in eine kaiserliche Familie ein. Natürlich muss sich auch noch die andere Prophezeiung erfüllen, und Julien tötet in einem Anfall von Eifersucht seine Eltern, die er für seine Frau und einen Liebhaber hält. Wie zu erwarten wendet er sich nun ab vom weltlichen Wohlleben und wird Fährmann an einem Fluss, lebt in Armut und im Dienst an seinem Mitmenschen. Erlöst wird er am Ende durch Jesus selbst, der ihm in Gestalt eines Aussätzigen erscheint und von ihm nicht nur Gastfreundschaft, sondern Dienst und Demut weit darüber hinaus erbittet. Bei der Geschichte handelt es sich offenbar um eine erzählerische Handübung; Flaubert spricht selbst davon, er habe die Drei Erzählungen als »Buch des Ausruhens« geschrieben.
Herodias erzählt in einiger Ausführlichkeit die Fabel vom Tod Johannes des Täufers, wie sie ihn den Evangelien des Matthäus und des Markus zu finden ist. Die Perspektive ist dabei die des Herodes Antipas, der sich eingezwängt sieht zwischen den Machtansprüchen der Römer, den Drohungen des Araber, den Vorurteilen der Juden und dem Versuch, die Liebe seiner Frau Herodias zurückzugewinnen. Höhepunkte der Erzählung ist sicherlich die große Strafpredigt des Johannes, die unmittelbarer Auslöser seiner Hinrichtung wird, da er in ihr öffentlich sowohl Herodes als auch Herodias bloßstellt, und die Hinrichtung des Johannes, die zwar hinter den Kulissen bleibt, deren Umstände aber ein letztes Mal die Bedeutung Johannes des Täufers bestätigen. Auch in diesem Fall sollte man nur ein artistisches Interesse Flauberts am Stoff voraussetzen und nicht annehmen, dass es ihm um die eine oder andere Botschaft gegangen sei.
Die Drei Erzählungen waren ein bedeutender Erfolg bei Kollegen und Kritikern, brachten aber nicht die von Flaubert erhofften Einkünfte. Zwar hatte er die Erzählungen vorab zu sehr guten Zeilenhonoraren zwei Zeitungen verkaufen können, aber die Buchausgabe blieb hinter seinen Erwartungen zurück. So war das Buch, das eine kleine artistische Werkschau ist, in Flauberts Einschätzung ein Misserfolg.
Gustave Flaubert: Drei Erzählungen. Aus dem Französischen von Claus Sprick und Cornelia Hasting. Zürich: Haffmans, 2000. Leinenrücken, Dünndruckpapier, Fadenheftung, Lesebändchen, 140 Seiten.