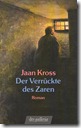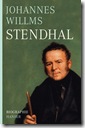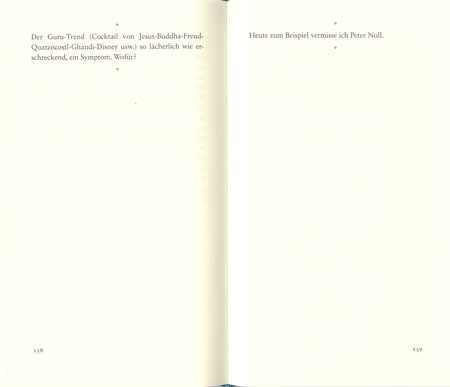Der fünfte Roman der Rougon-Macquart schließt nahezu unmittelbar an den vierten, »Die Eroberung von Plassans«, an. Im Mittelpunkt steht Serge, der Sohn von François und Marthe Mouret, der im vorangegangenen Buch bereits das Priesterseminar besucht hatte und nun in dem winzigen Ort Les Artaud Priester ist. Bei ihm lebt auch seine Schwester Désirée, die zwar geistig etwas zurückgeblieben zu sein scheint, nichtsdestotrotz aber der wohl glücklichste Mensch im ganzen Roman ist. Serge Mouret scheint zuerst nur ein etwas schüchterner, den Ansprüchen seiner bäuerlich-robusten Gemeinde nicht ganz gewachsener Geistlicher zu sein, doch erweist er sich rasch als Opfer eines tiefen religiösen Wahns, der sich in einem privaten Kult der Marienverehrung manifestiert.
Der fünfte Roman der Rougon-Macquart schließt nahezu unmittelbar an den vierten, »Die Eroberung von Plassans«, an. Im Mittelpunkt steht Serge, der Sohn von François und Marthe Mouret, der im vorangegangenen Buch bereits das Priesterseminar besucht hatte und nun in dem winzigen Ort Les Artaud Priester ist. Bei ihm lebt auch seine Schwester Désirée, die zwar geistig etwas zurückgeblieben zu sein scheint, nichtsdestotrotz aber der wohl glücklichste Mensch im ganzen Roman ist. Serge Mouret scheint zuerst nur ein etwas schüchterner, den Ansprüchen seiner bäuerlich-robusten Gemeinde nicht ganz gewachsener Geistlicher zu sein, doch erweist er sich rasch als Opfer eines tiefen religiösen Wahns, der sich in einem privaten Kult der Marienverehrung manifestiert.
Überfordert von seinen seelsorgerischen Pflichten und überspannt durch seinen Wahn bricht er eines Nachts zusammen und wird von seinem Onkel, dem Doktor Pascal aus Plassans, zur Pflege in ein nahe gelegenes Refugium gebracht: das Paradou, einen ehemaligen herrschaftlichen Garten, der inzwischen verwildert ist. Dort lebt Albine, ein kaum 16-jähriges Mädchen, mit ihrem Onkel Jeanbernat, einem eingefleischten Atheisten, der das Mädchen ebenso hat verwildern lassen wie den Garten. Serge ist durch seinen Zusammenbruch seines Gedächtnisses beraubt worden und so in einen Zustand der Unschuld zurückversetzt worden. Der Prozess seiner Genesung ist eng verknüpft mit der Erforschung des riesigen Gartens und dem Wachsen der Liebe zwischen Albine und ihm. Dieser Prozess gipfelt darin, dass Albine eine geheimnisvolle Lichtung im Park entdeckt, in deren Zentrum ein uralter Baum steht. Dort lieben sich Albine und Serge zum ersten Mal, und Serge, auf diese Weise wieder vollständig gesundet, findet sein Gedächtnis wieder und muss in die Welt zurück.
Der dritte Teil des Romans resümiert den angerichteten Schaden: Serge hat sowohl seinen religiösen Glauben des ersten, als auch den unreflektierten Zugang zur Natur des zweiten Teiles verloren. Zwar erfüllt er auch weiterhin die Pflichten als Pfarrer, doch hat er seinen Marienkult zugunsten eines Kreuzkultes aufgegeben. Doch die scheinbar wiedererlangte Normalität seines Lebens wird durchbrochen, als Albine ihn in der Kirche aufsucht. Diese Begegnung löst in Serge eine massive Vision aus, in der das Kirchengebäude von der Natur angegriffen und vollständig zerstört wird. Serge ist daraufhin bereit, zu Albine ins Paradou zurückzukehren, doch erweist sich natürlich die einmal verlorene Unschuld als unwiederbringlich. Albine bereitet sich ein Sterbelager aus Blumen und vergeht zwischen ihnen. Serge nimmt zu seine Pflichten als Pfarrer wieder auf und mit der Beisetzung Albines endet der Roman.
Vielleicht macht diese Inhaltsangabe schon deutlich, dass es sich bei »Die Sünde des Abbé Mouret« um einen ungewöhnlichen Roman Zolas handelt. Neben seiner grundlegenden naturalistischen Tendenz weist er zusätzlich klar symbolistische Strukturen auf. Besonders im zweiten, mittleren Teil des Romans geraten der zur Natur verwilderte Garten und die zur Unschuld zurückgekehrten Kinder zu einer Allegorie des Paradieses. Die reine Liebe zwischen Albine und Serge verkommt aber im Laufe von Serges Gesundung, bis sich die Natur ihr Recht verschafft. In Zolas Paradies gibt es keinen personifizierten Verführer, sondern die Natur selbst ist es, die die Unschuldigen zur Sünde verführt. Wie wichtig Zola diese Allegorie war, wird nicht zuletzt dadurch deutlich, dass er aus dem in der Dorfschule unterrichtenden Klosterbruder zugleich einen Erzengel – Bruder Archangias – macht, der denn auch pünktlich am Ausgang des Paradou steht, um in Serge Adam zum zweiten Mal aus dem Paradies hinauszuweisen. Auch Désirée ist in diese allegorische Ebene des Romans eingebunden: Sie betreibt bei der Pfarre selbstständig einen kleinen Wirtschaftshof und steht mit ihrem pragmatischen Umgang mit der nützlichen Natur in der Mitte zwischen Serges Naturphobie und Albines romantisierender Unschuld. In Désirées Welt sind Geburt und Tod notwendige Elemente im Prozess alles Lebendigen.
Es wäre aber verfehlt, »Die Sünde des Abbé Mouret« aufgrund dieser symbolistischen Tendenzen für einen nicht-naturalistischen Ausrutscher Zolas zu halten. Gerade im zentralen allegorischen Teil des Buches frönt Zola ausgiebig einem überschwänglichen Realismus: Weite Passagen der Beschreibung des Paradou lesen sich wie ein umgestülptes botanisches Bestimmungsbuch; ebenso herrscht bei der Darstellung des Gottesdienstes und der dafür nötigen Zurüstungen und Gerätschaften eine minutiöse Detailversessenheit, die nahtlos an »Die Beute« und »Der Bauch von Paris« anschließt. Und auch bei der Schilderung des Dorfes Les Artaud und seiner Bewohner lässt Zola seinen präzisen Blick nicht vermissen: Ehen sind auch hier in erster Linie eine Frage des Geldes und erst in zweiter oder dritter eine der Moral, heidnische Rituale und christlicher Glaube existieren fröhlich Seite an Seite, und in der Kirche bewundern die Bauern mehr die Eloquenz des Priesters oder die frisch gestrichenen Möbel als die gepredigten Glaubensinhalte. Und nicht zuletzt dürfte die handfeste Schlägerei zwischen Bruder Archangias und dem Atheisten Jeanbernat ein Bild von der Lage der katholischen Kirche in Frankreich zeichnen, das weder dem Bürgertum noch der Geistlichkeit gefallen haben dürfte.
»Die Sünde des Abbé Mouret« erweist sich als eine überraschende Mischung zeitgenössischer Stile und liefert trotz aller Allegorie mit der innerlich und äußerlich kleinen Welt, die er präsentiert, einen weiteren wesentlichen Mosaikstein zum umfassenden soziologischen Porträt des Zweiten Kaiserreichs.
Übersichtsseite zur Rougon-Macquart
Émile Zola: Die Rougon-Macquart. Natur- und Sozialgeschichte einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich. Hg. v. Rita Schober. Berlin: Rütten & Loening, 1952–1976. Digitale Bibliothek Bd. 128. Berlin: Directmedia Publ. GmbH, 2005. 1 CD-ROM. Systemvoraussetzungen: PC ab 486; 64 MB RAM; Grafikkarte ab 640×480 Pixel, 256 Farben; CD-ROM-Laufwerk; MS Windows (98, ME, NT, 2000, XP oder Vista) oder MAC ab MacOS 10.3; 256 MB RAM; CD-ROM-Laufwerk. 10,– €.
 An den Haaren herbeigezogener Psychothriller mit einem unzuverlässigen personalen Erzähler. Die erzählte Fabel ist bis ins Detail zu unwahrscheinlich und unausgegoren, um sie hier nacherzählen zu müssen. Ich hatte überhaupt nur zu dem Buch gegriffen, da von Lehane die Romanvorlage zum Film »Mystic River« stammt, der mir gut gefallen hat. Ich hätte eben auf meine Instinkte hören und zurückzucken sollen, als ich auf der Rückseite des Buches geschrieben fand, das Buch sei »für jeden anspruchsvollen Thriller-Fan ein Muss« und das Wort »genial« gleich noch dahinter angehängt. Wenn dies tatsächlich die Lektüre anspruchsvoller Thriller-Fans darstellt, was müssen sich dann wohl die armen ohne Anspruch zu Gemüte führen?
An den Haaren herbeigezogener Psychothriller mit einem unzuverlässigen personalen Erzähler. Die erzählte Fabel ist bis ins Detail zu unwahrscheinlich und unausgegoren, um sie hier nacherzählen zu müssen. Ich hatte überhaupt nur zu dem Buch gegriffen, da von Lehane die Romanvorlage zum Film »Mystic River« stammt, der mir gut gefallen hat. Ich hätte eben auf meine Instinkte hören und zurückzucken sollen, als ich auf der Rückseite des Buches geschrieben fand, das Buch sei »für jeden anspruchsvollen Thriller-Fan ein Muss« und das Wort »genial« gleich noch dahinter angehängt. Wenn dies tatsächlich die Lektüre anspruchsvoller Thriller-Fans darstellt, was müssen sich dann wohl die armen ohne Anspruch zu Gemüte führen?