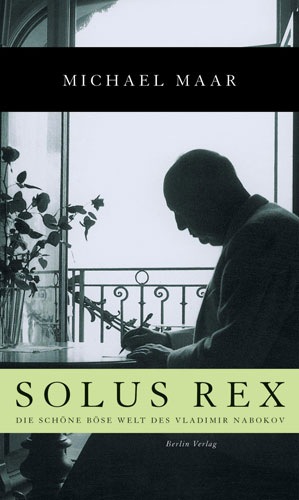Ziemlich fürchterliches Machwerk aus den 50er Jahren, geschrieben von einer russischen Emigrantin, die versucht, liberaler als Adam Smith zu sein. Es scheint bis heute in den USA eine nicht unbeträchtliche Anzahl von »Anhängern« zu haben. Dabei handelt es sich weniger um ein literarisches Werk, als vielmehr um eine ideologische Abhandlung im Gewand eines fiktionalen 1.000-Seiters. Die Autorin hatte ursprünglich erhebliche Schwierigkeiten, einen Verlag für ihr Machwerk zu finden, da alle vernünftigen Leute ihr anrieten, das Buch erheblich zu kürzen. Dass sie sich schließlich durchgesetzt hat, entspricht ganz und gar der rechthaberischen und verbiesterten Grundhaltung, die dieses gänzlich humorlose Werk auszeichnet.
Ziemlich fürchterliches Machwerk aus den 50er Jahren, geschrieben von einer russischen Emigrantin, die versucht, liberaler als Adam Smith zu sein. Es scheint bis heute in den USA eine nicht unbeträchtliche Anzahl von »Anhängern« zu haben. Dabei handelt es sich weniger um ein literarisches Werk, als vielmehr um eine ideologische Abhandlung im Gewand eines fiktionalen 1.000-Seiters. Die Autorin hatte ursprünglich erhebliche Schwierigkeiten, einen Verlag für ihr Machwerk zu finden, da alle vernünftigen Leute ihr anrieten, das Buch erheblich zu kürzen. Dass sie sich schließlich durchgesetzt hat, entspricht ganz und gar der rechthaberischen und verbiesterten Grundhaltung, die dieses gänzlich humorlose Werk auszeichnet.
Erzählt wird von einer zeitlich nicht genauer bestimmten utopischen Zukunft. Technisch scheint man sich in etwa auf dem Niveau der 30er-Jahre zu befinden: Eisenbahnen bilden das hauptsächliche Fernverkehrsmittel, Flugzeuge sind noch keine ernsthafte Konkurrenz zur Eisenbahn, Automobile aber schon gebräuchlich; neben Zeitungen ist das wichtigste Massenmedium das Radio, während das Fernsehen nicht zu existieren scheint. Dieser technologisch relativ genauen Ortsbestimmung, steht eine gänzlich fiktive Weltordnung gegenüber: Der Großteil der Länder in Europa und Südamerika scheint sozialistisch oder kommunistisch organisiert zu sein, was nahezu ausschließlich in der Bezeichnung all dieser Länder als »Volksrepubliken« zum Ausdruck kommt – die Autorin bleibt genauere Auskünfte darüber, wie diese Länder tatsächlich staatlich organisiert sind ebenso wie über vieles andere schuldig. Zumindest in den USA und Argentinien scheint der Privatbesitz an Produktionsmitteln aber nicht eingeschränkt zu sein. Doch herrscht in den USA keine freie Marktwirtschaft, da das wirtschaftliche Geschehen von mächtigen Interessenverbänden, die als legale Kartelle agieren, beherrscht wird. Weltweit herrscht Mangelwirtschaft, wobei die Autorin suggeriert, dies sei keine Folge eines objektiven Mangels an Ressourcen, sondern der rigiden wirtschaftlichen Beschränkungen durch die Kartelle bzw. die sozialistischen Regierungen.
Vor diesem Hintergrund wird das Leben Dagny Taggarts erzählt, die zusammen mit ihrem Bruder eines der größten US-amerikanischen Eisenbahn-Unternehmen leitet. Das Unternehmen befindet sich in einer ernsthaften Krise, aus der sich allerdings ein Ausweg weist, den Dagny mit der Hilfe des Stahlfabrikanten Henry Rearden, der gerade eine neue, leichtere und leistungsfähigere Stahlvariante erfunden hat, zu realisieren versucht. Beide stoßen dabei auf heftigen Widerstand der Kartelle – zu deren Vertretern auch Dagnys Bruder gehört –, den sie aber aufgrund ihrer herausragenden Persönlichkeiten und ihres genialen Erfindungsreichtums glanzvoll überwinden können.
Als zusätzliche Schwierigkeit erweist sich, dass das wirtschaftliche Geschehen vom einem Geheimbund beeinflusst wird, dessen mythenumwitterter Anführer John Galt sich im letzten Drittel des 1.000-Seiters in einer dreistündigen Radioansprache offenbart. Ziel dieses Geheimbundes ist es, alle kreativen Köpfe der ganzen Welt aus dem Verkehr zu ziehen, um ihre Ausnutzung durch die mediokre Mehrheit der Menschen zu unterbinden. Das Konzept ist exakt so dämlich, wie es sich anhört.
Da die Fabel des Romans bereits nach einem Drittel ziemlich klar umrissen ist und die zahlreichen Charaktere nahezu ausschließlich funktional bestimmt sind, erschöpft sich das Konzept des Buches rasch. Da es zudem sprachlich und motivisch trivial bleibt, ist es literarisch von keinerlei Bedeutung. Würde es sich darin erschöpfen, wäre es sicherlich längst und zu Recht vergessen.
Was das Buch im Druck hält, ist die vom Anführer vertretene Ideologie, ein kruder moralischer Egoismus, der in der schon erwähnten dreistündigen Radioansprache in einem extrem redundanten Stil ausgebreitet wird. Die Position selbst ist philosophisch indiskutabel, besteht ausschließlich aus einer Aneinanderreihung von Thesen und sogenannten Axiomen in einem sehr minimalistischen argumentativen Umfeld und wird im Ton anmaßender Überheblichkeit vorgetragen. Es scheint für diese Art des Hau-Ruck-Denkens, das sich formal nur unwesentlich von dem der Scientologen oder der Zeugen Jehovas unterscheidet, eine nicht unbedeutende Anzahl von Abnehmern zu geben.
Die Lektüre dieses Buches ist in jeder Hinsicht Zeitverschwendung.
Ayn Rand: Atlas Shrugged. London: Signet, 271997. Broschur, 1079 Seiten. Ca. 7,– €.