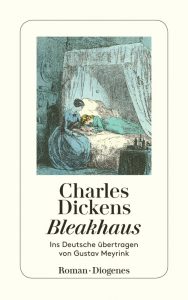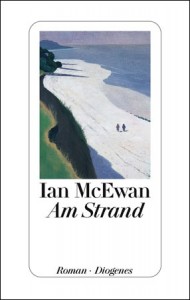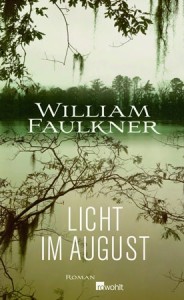Im Jahr 2007 sind zwei umfangreiche Kleist-Biografien erschienen: Zum einen von dem renommierten Germanisten Gerhard Schulz bei C. H. Beck, zum anderen vom Journalisten und Kulturwissenschaftler Jens Bisky bei Rowohlt Berlin. Diesen beiden Bänden tritt ein deutlich schmaleres Bändchen von Peter Staengle, Mitherausgeber der Brandenburger Kleist-Ausgabe, an die Seite, das 2006 beim Kleist-Archiv Sembdner in Heilbronn erschienen ist.
 Als gänzlich missraten muss leider Gerhard Schulzens Kleist-Biografie angesehen werden. Das Buch neigt zur Stilblüte, ist allgemein geschwätzig in dem Sinne, dass dem Autor zu irgend einem Detail im Lebens Kleists immer auch noch etwas anderes einfällt, was mit der Sache aber wenig bis nichts zu tun hat, bleibt im Einzelnen oberflächlich, weist zahlreiche offenbare Widersprüche auf, die unvermittelt nebeneinander stehen und was der Mängel mehr sind. Für all dies können hier nur Pars pro Toto einige Beispiel geliefert werden. Sätze wie etwa der folgende, finden sich durchgängig:
Als gänzlich missraten muss leider Gerhard Schulzens Kleist-Biografie angesehen werden. Das Buch neigt zur Stilblüte, ist allgemein geschwätzig in dem Sinne, dass dem Autor zu irgend einem Detail im Lebens Kleists immer auch noch etwas anderes einfällt, was mit der Sache aber wenig bis nichts zu tun hat, bleibt im Einzelnen oberflächlich, weist zahlreiche offenbare Widersprüche auf, die unvermittelt nebeneinander stehen und was der Mängel mehr sind. Für all dies können hier nur Pars pro Toto einige Beispiel geliefert werden. Sätze wie etwa der folgende, finden sich durchgängig:
Kleist hatte allerdings schon früh in seiner Potsdamer Zeit die Klarinette gewählt und sich darin unterrichten lassen, jenes [sic!] Instrument, von dem man sagte, [sic!] daß es der menschlichen Stimme am nächsten komme, obwohl [sic!] es damals anders klang als heute.
Welche logische Beziehung mag hier durch das Wort »obwohl« ausgedrückt sein? Und was mag das nächste Zitat sagen wollen?
Und so war es damals auch eher förderlich für Kleist, daß sein eigener Aufsatz zunächst in der großen Verborgenheit des Ungedruckten blieb.
An anderer Stelle wird Kleists Abschied vom Militär mit Schillers Desertion in Beziehung gesetzt, um zu dem Ergebnis zu gelangen, dass beide zuvor im Militär waren und nachher nicht mehr. Da findet sich eine gute Seite Text zu Prinz Louis Ferdinand, auf der auch Theodor Fontanes bekanntes Gedicht zitiert wird, um nachher altklug anzumerken, es stimme »nur bedingt«, und in folgender Passage zu gipfeln:
Ob Kleist und Louis Ferdinand einander je begegnet sind, ist nicht überliefert. Sehr früh hat Kleist jedoch in Potsdam einen der «Genossen» des Prinzen kennengelernt: Peter von Gualtieri, der sich Pierre nannte, wie er es überhaupt vorzog, französisch zu sprechen und zu schreiben, selbst an Goethe.
Man denke: Auf Französisch selbst an Goethe! Das waren wilde Zeiten!
Was die kulturellen und intellektuellen Zeitumstände angeht, herrscht bei Schulz im besten Fall Verwirrtheit vor:
Im gleichen Jahre 1777, in dem Heinrich von Kleist geboren wurde, verfaßte sein Landesherr, der Preußenkönig Friedrich II., einen Essay über Regierungsformen und Herrscherpflichten. Darin betrachtete er «die große Wahrheit, daß wir gegen die anderen so handeln sollen, wie wir von ihnen behandelt zu werden wünschen», als «Grundlage der Gesetze» – elf Jahre später erhob Kant diese Wahrheit zum kategorischen Imperativ und «Grundgesetz» der «praktischen Vernunft», also der Sittlichkeit schlechthin.
Auch wenn es ein beliebter Irrtum ist, wird die Gleichsetzung von Goldener Regel und kategorischem Imperativ auch durch Wiederholung nicht richtiger.
An der Schwelle zum technisch-industriellen Zeitalter waren die Naturwissenschaften erst allmählich im Begriff, eigenständig zu werden und sich zu differenzieren – Physik schloß oft noch die Chemie mit ein. Demzufolge bildete Mathematik auch nicht die Zuträgerin von Anwendbarem, sondern war reine Wissenschaft aus der Denkschule vor allem von Leibniz.
Newtons die neue Physik begründendes Buch von 1687 trägt den Titel Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Und Daniel Bernoulli und Leonhard Euler dürften sich für die »Denkschule vor allem von Leibniz« auch herzlich bedankt haben.
Aber auch was Kleist selbst angeht, kann sich Schulz zu keiner auch nur einigermaßen stimmigen Meinung entschließen:
Kleist war seinem Wesen nach ein geselliger, der Freundschaft fähiger wie ihrer bedürftiger Mensch.
[…] der eher Menschenscheue […]
[…] so gesellig er war, so einsam konnte und wollte er zuweilen sein […]
Immer so, wie’s gerade passt, nicht wahr Gevatter?
Das alles sind wohlgemerkt nur wenige von zahlreichen Funden, die sich bereits auf den ersten 100 Seiten dieses Buches machen lassen. Auch dieses Werk wäre wohl besser »in der großen Verborgenheit des Ungedruckten« geblieben!
 Im Gegensatz dazu macht Jens Biskys Biografie einen soliden Eindruck. Auch Bisky liebt zwar die Abschweifung und die ausführliche Darstellung von Informationen zur Zeit Kleists, die man auch andernorts leicht finden könnte, doch insgesamt ist sein Buch ein Zeugnis beeindruckenden Fleißes. Das geht soweit, dass dem Leser an einigen Stellen gänzlich unnötig die absonderlichsten Theorien zu Kleist referiert werden, nur um anschließend zu betonen, all dies sei Spekulation oder Irrtum. Dies macht die Lektüre in manchen Passagen mühsam. Besonders der Fachmann hat Mühe, das Wesentliche unter dem Beiläufigen und Selbstverständlichen herauszufiltern, während der Laie die Lektüre angesichts der schieren Masse von Material wohl gern einstellen würde. An einigen Stellen neigt Bisky auch zur Überinterpretation, so etwa, wenn er versucht, Einheit und Sinn in Kleists frühe Briefe zu bringen, wo etwa Staengle sehr bodenständig und richtig urteilt:
Im Gegensatz dazu macht Jens Biskys Biografie einen soliden Eindruck. Auch Bisky liebt zwar die Abschweifung und die ausführliche Darstellung von Informationen zur Zeit Kleists, die man auch andernorts leicht finden könnte, doch insgesamt ist sein Buch ein Zeugnis beeindruckenden Fleißes. Das geht soweit, dass dem Leser an einigen Stellen gänzlich unnötig die absonderlichsten Theorien zu Kleist referiert werden, nur um anschließend zu betonen, all dies sei Spekulation oder Irrtum. Dies macht die Lektüre in manchen Passagen mühsam. Besonders der Fachmann hat Mühe, das Wesentliche unter dem Beiläufigen und Selbstverständlichen herauszufiltern, während der Laie die Lektüre angesichts der schieren Masse von Material wohl gern einstellen würde. An einigen Stellen neigt Bisky auch zur Überinterpretation, so etwa, wenn er versucht, Einheit und Sinn in Kleists frühe Briefe zu bringen, wo etwa Staengle sehr bodenständig und richtig urteilt:
Kleists Briefe in dieser Zeit beschwören ein Bild verzweifelter Orientierungslosigkeit.
Schwächen finden sich auch in der Darstellung der spezifisch deutschen Aufklärung – Lessings Position fehlt komplett; Kants Projekt wird weder von Kleist noch von Bisky richtig verstanden – und der zeitgenössischen Philosophie. Beides ist aber in Bezug auf Kleist zu verschmerzen.
Über einzelne sprachliche Eigenheiten (»Hier wird mit der Zauberrute der Analogie gedacht« oder »Hier liegt der Knüppel beim Hund«) mag man hinwegsehen wollen. Was schmerzlich fehlt ist ein Werkregister, das einen gezielten Zugriff auf die Analyse einzelner Texte Kleists erlauben würde. Die Interpretationen selbst sind nach meinem Geschmack zu oberflächlich und bleiben zu sehr dem offensichtlichen verhaftet, sind aber für jemanden, der sich über Kleist Orientierung verschaffen will, wahrscheinlich nützlich und eine eigene erste Lektüre stützend. Die Erzählungen kommen leider (einmal mehr) deutlich zu kurz.
 Peter Staengles Darstellung konzentriert sich in der Hauptsache auf das Leben Kleists und gibt zu den Werken und ihrer Interpretation eher verhalten Auskunft. Das, was wir über Kleists Leben wissen, wird knapp, präzise und korrekt referiert. Dort, wo Staengle Hinweise zur Interpretation der Werke gibt, sind sie ebenso kurz, wie in die richtige Richtung weisend. Man wünscht sich bald, Staengle und nicht Bisky hätte die umfangreichere Darstellung verfasst. Das Buch ist in dem, was es leisten will und leistet, nahezu als tadellos zu bezeichnen, allerdings liefert es oft eben nur die äußere Schale für das, weswegen Kleist für uns von Interesse ist: das Werk. Wie oben bereits gesagt, sind Staengles Zugriffe normalerweise bodenständig und sehr konkret; er benennt das, was wir wissen, ebenso direkt und ungekünstelt wie das, was wir nicht wissen. Insgesamt sicherlich die angenehmste Lektüre unter den drei Neuerscheinungen.
Peter Staengles Darstellung konzentriert sich in der Hauptsache auf das Leben Kleists und gibt zu den Werken und ihrer Interpretation eher verhalten Auskunft. Das, was wir über Kleists Leben wissen, wird knapp, präzise und korrekt referiert. Dort, wo Staengle Hinweise zur Interpretation der Werke gibt, sind sie ebenso kurz, wie in die richtige Richtung weisend. Man wünscht sich bald, Staengle und nicht Bisky hätte die umfangreichere Darstellung verfasst. Das Buch ist in dem, was es leisten will und leistet, nahezu als tadellos zu bezeichnen, allerdings liefert es oft eben nur die äußere Schale für das, weswegen Kleist für uns von Interesse ist: das Werk. Wie oben bereits gesagt, sind Staengles Zugriffe normalerweise bodenständig und sehr konkret; er benennt das, was wir wissen, ebenso direkt und ungekünstelt wie das, was wir nicht wissen. Insgesamt sicherlich die angenehmste Lektüre unter den drei Neuerscheinungen.
 Es bleibt am Ende nur noch auf die bereits 2003 bei Wallstein erschienene Biografie Kleists von Rudolf Loch hinzuweisen: Sie ist unter den umfassenden Biografien immer noch die lesbarste und ausgewogenste, die den Anspruch einer Einführung in Leben und Werk zurzeit aufs Beste einlöst. Loch ist ein ausgewiesener Kenner Kleists, was besonders seinen Werkdeutungen zugute kommt. Sicherlich bleibt auch hier vieles ungesagt und die Interpretation zeigt alles in allem eine Neigung zur Glättung der Texte, aber eine radikale Problematisierung, wie sie für das Verständnis Kleists letztendlich nötig ist, kann von einer Gesamtdarstellung mit Fug nicht erwartet werden. Auch vom Inhalt abgesehen ist dies sicherlich das schönste Buch unter den hier vorgestellten: Nicht nur hat es einen sehr angenehmen Satzspiegel, es verfügt auch über lebende Kolumnentitel und ist fadengeheftet!
Es bleibt am Ende nur noch auf die bereits 2003 bei Wallstein erschienene Biografie Kleists von Rudolf Loch hinzuweisen: Sie ist unter den umfassenden Biografien immer noch die lesbarste und ausgewogenste, die den Anspruch einer Einführung in Leben und Werk zurzeit aufs Beste einlöst. Loch ist ein ausgewiesener Kenner Kleists, was besonders seinen Werkdeutungen zugute kommt. Sicherlich bleibt auch hier vieles ungesagt und die Interpretation zeigt alles in allem eine Neigung zur Glättung der Texte, aber eine radikale Problematisierung, wie sie für das Verständnis Kleists letztendlich nötig ist, kann von einer Gesamtdarstellung mit Fug nicht erwartet werden. Auch vom Inhalt abgesehen ist dies sicherlich das schönste Buch unter den hier vorgestellten: Nicht nur hat es einen sehr angenehmen Satzspiegel, es verfügt auch über lebende Kolumnentitel und ist fadengeheftet!
Wem also im Wesentlichen eine Lebensbeschreibung mit kurzen Abrissen zu den Werken genügt, greife zum Buch von Staengle, wer eine umfassendere Darstellung sucht, lasse die Finger von den beiden neueren Publikationen, sondern greife zum Buch von Loch.
Gerhard Schulz: Kleist. Eine Biographie. München: C.H. Beck, 2007. Leinen, Lesebändchen, 608 Seiten. 26,90 €.
Jens Bisky: Kleist. Eine Biographie. Berlin: Rowohlt Berlin, 2007. Pappband, Lesebändchen, 528 Seiten. 22,90 €.
Peter Staengle: Kleist. Sein Leben. Heilbronn: Kleist-Archiv Sembdner, 2006. Broschur, 241 Seiten. 8,– €.
Rudolf Loch: Kleist. Eine Biographie. Göttingen: Wallstein, 2003. Pappband, fadengeheftet, 542 Seiten. 37,– €.
 Der Titel spielt auf eine im angelsächsischen Raum recht bekannte zweibändige Essaysammlung Virginia Woolfs an, die The Common Reader überschrieben ist, was wiederum ein Ausdruck Dr. Johnsons ist. Im Mittelpunkt von Bennetts Erzählung steht nun allerdings eine äußerst ungewöhnliche Leserin: Queen Elizabeth II., die beim Gassigehen mit ihren Corgis hinter ihrem Palast zufällig auf einen Bücherbus stößt, der die Dienerschaft ihrer Majestät mit Lesestoff versorgt. Höflich, wie sie ist, betritt sie den Bus und trifft dort auf einen ihrer Küchenjungen, Norman Seakins. Und da sie nun einmal die Gelegenheit hat, entleiht sie als weiteres Zeichen ihrer königlichen Gnade einen Roman von Ivy Compton-Burnett, an deren Adelung sich die Königin noch gut erinnern kann.
Der Titel spielt auf eine im angelsächsischen Raum recht bekannte zweibändige Essaysammlung Virginia Woolfs an, die The Common Reader überschrieben ist, was wiederum ein Ausdruck Dr. Johnsons ist. Im Mittelpunkt von Bennetts Erzählung steht nun allerdings eine äußerst ungewöhnliche Leserin: Queen Elizabeth II., die beim Gassigehen mit ihren Corgis hinter ihrem Palast zufällig auf einen Bücherbus stößt, der die Dienerschaft ihrer Majestät mit Lesestoff versorgt. Höflich, wie sie ist, betritt sie den Bus und trifft dort auf einen ihrer Küchenjungen, Norman Seakins. Und da sie nun einmal die Gelegenheit hat, entleiht sie als weiteres Zeichen ihrer königlichen Gnade einen Roman von Ivy Compton-Burnett, an deren Adelung sich die Königin noch gut erinnern kann.