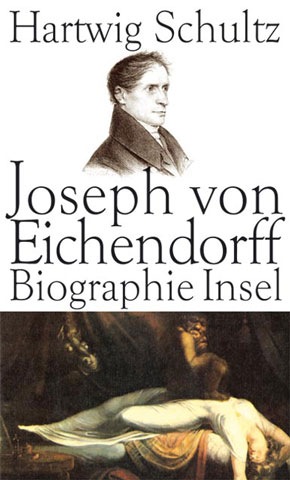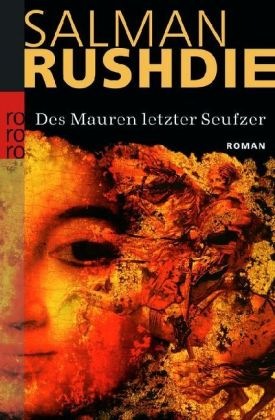Es scheint beinahe unmöglich, diesem Buch oder besser dem Autor im Fall dieses Buches gerecht zu werden. Nach einem Buch wie Die Stadt der träumenden Bücher (2005) muss einem Schriftsteller die Herausforderung, die nächste Fortsetzung der Zamonien-Romane zu schreiben, von überwältigenden Schwierigkeit erscheinen. Beinahe scheint es, dass sich Moers in der »Anmerkung des Übersetzers« dafür entschuldigt, keinen zweiten Teil der Stadt geschrieben zu haben, sondern auf eine eher kleine, beinahe unscheinbare Geschichte ausgewichen zu sein.
Es scheint beinahe unmöglich, diesem Buch oder besser dem Autor im Fall dieses Buches gerecht zu werden. Nach einem Buch wie Die Stadt der träumenden Bücher (2005) muss einem Schriftsteller die Herausforderung, die nächste Fortsetzung der Zamonien-Romane zu schreiben, von überwältigenden Schwierigkeit erscheinen. Beinahe scheint es, dass sich Moers in der »Anmerkung des Übersetzers« dafür entschuldigt, keinen zweiten Teil der Stadt geschrieben zu haben, sondern auf eine eher kleine, beinahe unscheinbare Geschichte ausgewichen zu sein.
Grundlage des Buches ist Gottfried Kellers Spiegel, das Kätzchen, ein »Märchen«, wie Keller selbst es benennt, das aber bei genauerer Betrachtung wenig Märchenhaftes aufweist, sondern sich erstaunlich konkret mit gesellschaftlichen Realitäten des 19. Jahrhunderts auseinandersetzt. Mit all dem kann natürlich Moers’ Transfer in zamonische Gefilde wenig anfangen, was auf der einen Seite zu einer Verflachung und Verharmlosung des Stoffes, auf der anderen Seite zu nicht unwesentlichen Eingriffen in den Text geführt hat, besonders was die Länge und das Ende betrifft. Für den Kenner Kellers macht Moers’ Buch den Eindruck, den eine schlechte Verfilmung machen kann, die einen eigentlich ungeeigneten Stoff unter Aufgabe von Sinn und Struktur in das eigene Medium einpresst.
Doch dieser Eindruck ist zumindest insoweit unerheblich, als dass Moers’ Buch durchaus den Anspruch machen kann, ganz für sich selbst zu stehen und Kellers Märchen für nicht mehr als eine Anregung genommen zu haben. Aber selbst wenn man darauf verzichtet, Moers und Keller nebeneinander zu halten, so kommt man nicht umhin, es mit dem Vorläufer zu vergleichen. Und in diesem Vergleich schneidet es enttäuschend ab: Wo Die Stadt der träumenden Bücher überschäumte von Wortwitz, phantastischen Einfällen und skurrilen Figuren, hat Der Schrecksenmeister einen Schuhu mit einer Sprachstörung bei Fremdwörtern, eine Ansammlung literarischer Motive klassischer Schauerromane und als einzige erwähnenswerte Erfindung die Ledermäuse, deren wesentlicher Witz in der wiederholten Feststellung besteht:
Niemand versteht die Ledermäuse! Nicht mal die Ledermäuse!
Würde dieses Buch nicht im Schatten seines Vorgängers stehen, so erschiene all das sicherlich im Rahmen des Gewöhnlichen und würde für ein nicht herausragendes, aber durchaus angängiges Buch ausreichen. Aber so wird Die Stadt der träumenden Bücher wohl zu jenem Fall werden, an dem sich das Schicksal aller folgenden zamonischen Romane entscheiden wird.
Wie der unsterbliche Laurence Sterne bei Anlass des berühmten herausgerissenen Kapitels des Tristram Shandy so richtig schrieb:
Ein Zwerg, der einen Maßstab bei sich führt, um damit seine eigene Länge zu messen, ist – glauben Sie mir’s auf mein Wort – in mehr als einem Sinne ein Zwerg.
Walter Moers: Der Schrecksenmeister. München: Piper, 2007. Bedruckter Pappband, Lesebändchen, farbiger Kopfschnitt, 384 Seiten. 22,90 €.