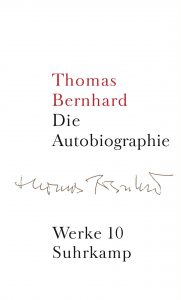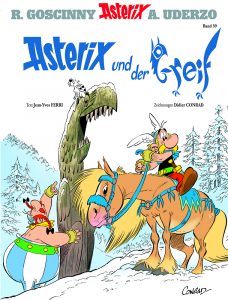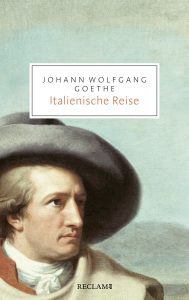… aber hier wird auf das Kopfschütteln, gleich auf welcher Seite und mag sie sich als die kompetenteste ansehen, keinerlei Rücksicht genommen.
Zwischen 1975 und 1982 sind fünf autobiographisch unterfütterte Erzählungen von Thomas Bernhard erschienen, die 2004 innerhalb der Werkausgabe bei Suhrkamp erstmals in einem Band, dem Band 10 unter dem herausgeberischen Titel Die Autobiographie zusammengefasst wurden. Die Herausgeber dieses Bandes stellen selbst fest, dass der gewählte Titel nicht durch irgend eine Äußerung des Autors gestützt werden kann. Es soll hier nicht diskutiert werden, inwieweit dieser neue Titel und die neue Form die Wahrnehmung und das Verständnis dieser Erzählungen beeinflussen, denn dazu wäre als Vergleichsgröße eine Dokumentation des Verständnisses eines Lesers vonnöten, der die Erzählungen etwa kontinuierlich mit ihrem Erscheinen gelesen hätte; allein schon das wäre wohl weit von jeder Realisierbarkeit entfernt. Doch genug des Nominalstils.
Die Reihe der Erzählungen beginnt mit der Internatszeit Bernhards in den letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsmonaten in Salzburg. Der Ich-Erzähler leidet sowohl unter dem Regiment des faschistischen Direktors Grünkranz als auch seines katholischen Nachfolgers „Onkel Franz“. Dieser erste Band, Die Ursache. Eine Andeutung (1975) endet mit dem Entschluss des Erzählers das Gymnasium zu verlassen und eine Lehre bei einem Lebensmittel-Händler zu beginnen. Der Keller. Eine Entziehung (1976) knüpft direkt an dieses Ende an und verfolgt die Lebensgeschichte weiter bis zum Abbruch der Lehre durch eine Lungenerkrankung, die sich der Erzähler beim Abladen einen Fuhre Kartoffeln im Regen zugezogen hat. Der Atem. Eine Entscheidung (1978) berichtet vom sich anschließenden Klinikaufenthalt, Die Kälte. Eine Isolation (1981) von der nachfolgenden Kur. Der letzte Band Ein Kind (1982) springt chronologisch in die Zeit vor Die Ursache und beginnt mit einer Radtour, die der Erzähler als Achtjähriger ohne die Erlaubnis seiner Mutter nach Salzburg unternommen hat, auf der er aber verunglückt, ohne sein Ziel zu erreichen. Nimmt man den erzählerischen Anspruch für einen Moment ernst, so erzählt Bernhard hier sein Leben einigermaßen kontinuierlich zwischen dem achten und dem neunzehnten Lebensjahr nach.
Dabei sind alle fünf Erzählungen beherrscht vom Ton und der Geisteshaltung des erwachsenen Erzählers, seinem durchgehenden Ressentiment eines Außenseiters gegen die Gesellschaft, den Menschen schlechthin, die Österreicher und die Salzburger im speziellen, dem unvergessenen und unverziehenen Leid des von einem ambitionierten Großvater durch diverse Künste (Geigenspiel, Gesang, Malerei) getrieben Kindes, das zusätzlich unter dem Druck einer ihm in Hass-Liebe zugetanen Mutter leidet und keinen heimischen Ort in der Welt finden kann. Die Texte sind einerseits durchaus bewegend, andererseits in der typischen Bernhardschen Manier nervtötend und penetrant. Bernhard zelebriert in dem Kind und Jugendlichen, von dem er erzählt, seine Verletztheit, Einsamkeit und Misanthropie. Es fehlt diesen Büchern in weiten Teilen der sonst oft bei ihm vorherrschende bissige oder auch zynische Humor, der hier ersetzt wird durch ein eher unverstelltes, aber distanziert geschildertes Mitleid mit sich selbst als Kind. Diese größere Unmittelbarkeit sollte einen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch diese Texte hoch stilisiert sind, dass die permanenten Wiederholungen, Reformulierungen und Variationen (die durchaus auch als musikalisches Element verstanden werden können) eine mehrfache Überschreibung des Erinnerten durch einen dies Erinnern instrumentalisierenden Erzähler darstellen.
Die fünf Erzählungen bilden einen guten Einstieg in den Bernhardschen Kosmos: Wer ausprobieren möchte, ob er mit Bernhards Stil zurecht kommt, kann es mit irgendeinem der Bände probieren; vielleicht ist Die Ursache der beste Prüfstein. Es ist aber nicht notwendig, bei der Lektüre die innere Chronologie oder die der Veröffentlichung einzuhalten.
Thomas Bernhard: Die Autobiographie. Werke Bd. 10. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2004. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen. 582 Seiten. 42,– €.