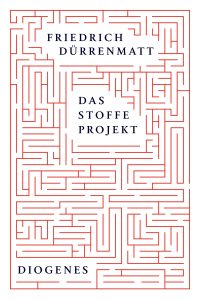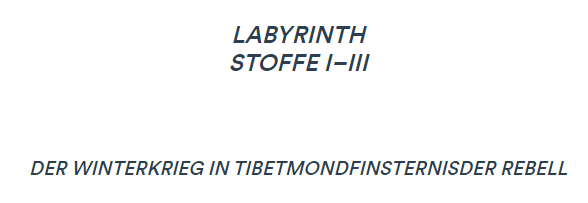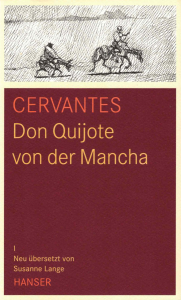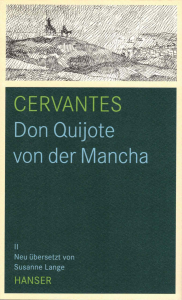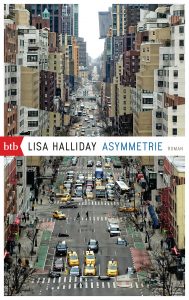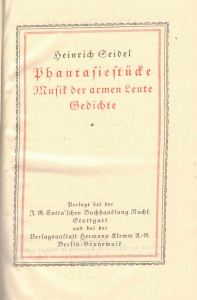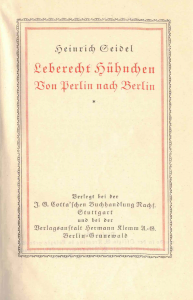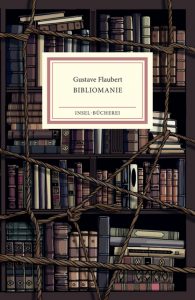It all gets very confusing and is best left to academics and those with time on their hands.
In Deutschland haben wir in nahezu jedem Bücherschrank „Die schönsten Sagen des klassischen Altertums“ von Gustav Schwab stehen. Wer es nicht zur Konfirmation bzw. Kommunion geschenkt bekommen hat, erbt es irgendwann oder – in ganz verzweifelten Fällen – kauft es sich, weil man das doch einmal richtig wissen will. Die einen haben noch das fragwürdige Glück, ein „für die heranwachsende Jugend“ bearbeitetes Exemplar zu besitzen, während andere wenigstens versuchen, sich durch den originalen Text aus den 1830er Jahren zu arbeiten.
Schwab schrieb seine Darstellung antiker Mythen für die erwachsene Leserin seiner Zeit, die sich bewusst war, dass sie für die Lektüre der gerade entstehenden klassischen und romantischen Fossilien die griechische Mythologie präsent haben sollte. Schwab sah sich gezwungen, seine Auswahl und Nacherzählung an die Sensibilität seiner Rezipientinnen anzupassen. So wie es im viktorianischen England den für den Familiengebrauch chemisch gereinigten Shakespeare der Geschwister Lamb gab, so folgt Schwab konsequent seinem Programm, nur die „schönsten“ Sagen seinen Leserinnen zu präsentieren. Daraus folgt zuerst einmal, dass die in der Hauptsache aus Verrat, Mord, inzestuösem Sex und Kannibalismus bestehende Theogonie – also die Geschichte von der Entstehung der Welt und der Götter – bei ihm so gut wie gar nicht vorkommt. Auch sonst ist Schwab so dezent wie möglich, und er behandelt seinen Stoff ganz ernsthaft als hohes und notwendiges Bildungsgut. Man kann schon an dieser Beschreibung ablesen, warum ein solches Projekt in Deutschland dauerhaft Erfolg haben musste.
Und so verhindern die universale Verbreitung des Schwab und seine kommerziell attraktive Gemeinfreiheit, dass wir in Deutschland eine elegante und zeitgemäße Nacherzählung der griechischen Mythen der Antike aus der Feder eines großen Stilisten haben. Zum Glück kann eine Übersetzung jetzt diese Lücke füllen!
Stephen Fry ist eine der erstaunlichen Multibegabungen, derer sich das englische Königreich rühmen darf: Zumindest als Schauspieler, Moderator, Regisseur und Schriftsteller hat er schon geglänzt, er ist ein mehr als ordentlicher Musiker, und es würde mich nicht wundern, wenn sich herausstellen würde, dass er heimlich auch als Maler tätig ist. Seit 2017 sind nun drei Bücher von ihm erschienen, in denen er die antiken griechischen Mythen nacherzählt, und er tut dies nicht nur mit souveränem Überblick und beeindruckender Belesenheit, sondern auch mit dem nötigen ironischen Abstand und Witz, um die Stoffe unterhaltsam an die heutigen Leserinnen und Leser zu bringen.
Die bis dato erschienenen Bände umfassen das gesamte für zumindest die drei letzten Jahrhunderte relevante Material (mit Ausnahme der Erzählungen der Odyssee, die wahrscheinlich den nächsten Band füllen werden), angefangen mit der Kosmologie und Theogonie der Griechen und endend mit der Erzählung um den 10 Jahre andauernden Helena-Krieg der Griechen und Trojaner.
Seltsamerweise habe ich nichts gefunden, über das ich mich beschweren könnte (einzig im ersten und dritten Band fehlt jeweils ein Inhaltsverzeichnis, was aber durch ein angehängtes Register wett gemacht wird). Fry erzählt die Mythen nicht nur stilistisch elegant und unaufgeregt nach, er lässt es unter den Göttern auch hübsch menscheln, lässt sie die hübschesten Banalitäten austauschen und macht die griechische Antike überhaupt so alltäglich, wie sie wohl einstmals auch gemeint gewesen ist. Das alles ist auch für einen Leser wie mich, der die Stoffe alle mehr oder weniger gut kennt, mit Vergnügen zu lesen und wieder zu lesen. Fry lässt auch die kleineren mythologischen Erzählungen (Hero und Leander, Philemon und Baucis etc.) nicht aus, er weiß überall kurze und sehr präzise Hinweise zur Deutung und Bedeutung der Mythen zu streuen, so dass man bemerkt, was hier noch zu heben wäre, wenn man Zeit und Lust dazu hat, aber dies geschieht immer nur nebenbei und mit leichter und sicherer Hand; und in den Fussnoten blitzt dann und wann Frys umfassende klassische Bildung auf.
Band 1 beginnt mit der Theogonie und umfasst die Mythen der Frühzeit (Erschaffung der Menschen, Kulturstiftung, Verwicklung und -mischung der Götter und Menschen); Band 2 konzentriert sich auf die Erzählung der sogenannte Heldenzeit der Griechen (Perseus, Herakles, Bellerophon, Orpheus, Jason, Atalanta, Ödipus und Theseus) und der 3. Band umfasst, wie schon der Titel sagt, den Sagenkreis um den Trojanischen Krieg herum. Ich warte nun mit Spannung auf die Nacherzählung der Odyssee, die wohl die Reihe beschließen wird.
Die ersten beiden Bände liegen auch schon auf Deutsch vor (bei Aufbau, übersetzt von Matthias Frings); ich habe keinen Zweifel, dass auch der dritte Band bereits in Arbeit ist.
- Stephen Fry: Mythos. o.O.: Penguin / Random House, 2018. Broschur, 442 Seiten. Etwa 10,– €.
- Stephen Fry: Heroes. o.O.: Penguin / Random House, 2019. Broschur, 476 Seiten. Etwa 10,– €.
- Stephen Fry: Troy. o.O.: Penguin / Random House, 2021. Broschur, 414 Seiten. Etwa 10,– €.