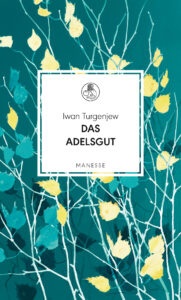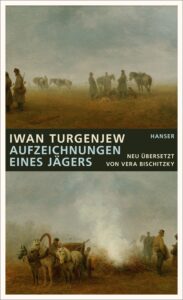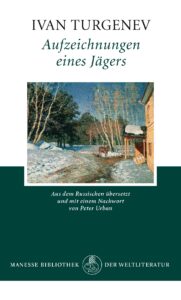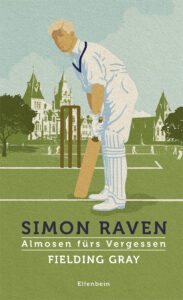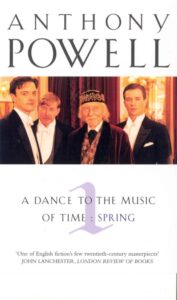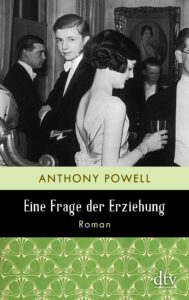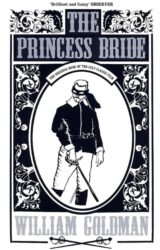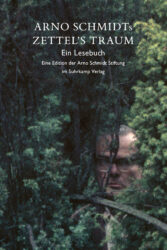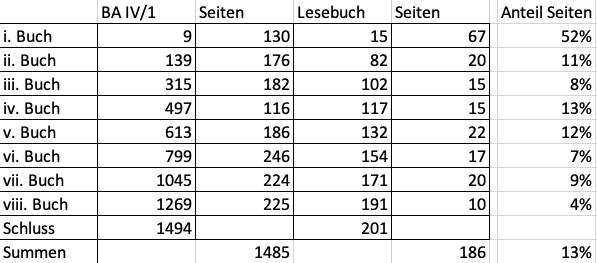Und Richard und Elizabeth waren ziemlich froh, dass es vorbei war …
Ein kleiner Roman, 1925 erschienen, der offensichtlich eine der frühen Reaktionen auf den Ulysses von James Joyce (1922) darstellt. Woolf experimentiert mit fließenden Übergängen zwischen personalem Erzählen mit wechselndem Fokus, erlebter Rede und stream of conciousness. Nachgebildet werden darüber hinaus hauptsächlich Erzähltechniken aus dem Irrfelsen-Kapitel. Erzählt werden ungefähr 12 Stunden eines Tages im Sommer 1923, an dessen Abend Clarissa Dalloway einen Empfang in ihrem Haus gibt, der den Gipfel und zugleich das Ende des Romans bildet. Dabei ist Mrs. Dalloway kaum mit der Vorbereitung des Empfangs beschäftigt – das einzige, was als Vorbereitung zählen kann, ist, dass sie ihr Kleid, an dem eine Kleinigkeit genäht werden muss, für den Abend herrichtet –, auch wenn ein bedeutender Teil ihres Denkens um die Bedeutung und den Erfolg des Abends kreist.
Unterbrochen werden diese Gedanken durch den Besuch ihrer Jugendliebe Peter Walsh, der gerade aus Indien zurückgekehrt ist, um in London die Scheidung seiner unglücklichen Ehe zu betreiben. Walsh hat sich auf seine alten Tage (er ist 52 Jahre alt) in eine junge, verheiratete Frau verliebt; ob dies mehr als eine Phantasie ist, lässt sich aus dem Text heraus kaum beurteilen. Außerdem verfolgt der Text für eine Weile den Tag von Richard Dalloway, der nach einer etwas merkwürdigen Einladung bei einer Lady Bruton in einem plötzlichen emotionalen Überschwang seiner Frau einen großen Strauß Rosen vorbeibringt, sich aber nicht dazu überreden kann, ihr zu sagen, dass er sie liebe. Auch von der gemeinsamen Tochter Elizabeth erfahren wir das eine oder andere, ebenso wie von einigen anderen Freunden und Bekannten der Dalloways.
Als soziales Gegengewicht zu dem ansonsten durchweg der Oberschicht angehörenden Personal fungiert das Ehepaar Septimus und Lucrezia Warren Smith. Septimus ist mit einem unerkannten psychischen Trauma aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt. Aus Italien, wohin es ihn im Krieg verschlagen hatte, hat er seine Ehefrau nach London mitgebracht. Er hat seine alte Stellung in einem Büro wieder angetreten, ist aber mit den Jahren mehr und mehr in eine Psychose abgerutscht, die sich nun in Visionen seines im Krieg gefallenen Vorgesetzten manifestiert. Seine Frau, die angesichts seines immer merkwürdiger werdenden Verhaltens langsam verzweifelt, bringt ihn an diesem Tag erstmals zu einem berühmten Nervenarzt, der wenigstens den Zusammenhang mit dem Kriegserleben erkennt und ihn für mindestes sechs Monate in einem Sanatorium unterbringen will. Man muss feststellen, dass diese Nebenhandlung wohl die aussagekräftigste und interessanteste im ganzen Buch ist.
Bei aller Anerkennung der artistischen Anstrengung bleibt leider festzustellen, dass das Buch an seinem weitgehend unerheblichen Personal scheitert. Es mag sein, dass es sich dabei um eine milde Satire auf die englische Oberschicht handeln soll – besonders die Schilderung des sozialen und intellektuellen Leerlaufs beim abendlichen Empfang im Hause Dalloway nährt diesen Verdacht –, doch ist das Objekt dieser Satire inzwischen so weit von uns entfernt, dass wir ihren Biss kaum mehr empfinden, sondern uns konstruieren müssten. Doch dafür ist der Text eindeutig zu lang geraten. Am Ende geht es uns so, wie Richard und Elizabeth: Wir sind ziemlich froh, dass es vorüber ist.
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway. Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser. RUB 18886. Stuttgart: Reclam, 2012. Broschur, 231 Seiten. 6,80 €.