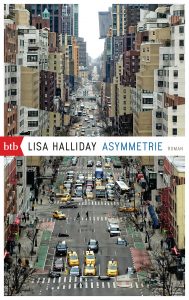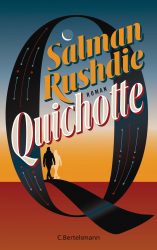Sei vorsichtig, hatte mich Alastair am Abend zuvor gewarnt, […] noch mehr als dein Bruder ist jemand wie du für diese Leute ein Hauptgewinn. Ein Schiit aus einer politischen Familie, die zwei der politischen Parteien angehört, die sie hassen, und mit Verbindungen in die grüne Zone und noch dazu amerikanischer Staatsbürger mit Familie in den USA und Ersparnissen in Dollar? Kannst du dir das vorstellen? »So viele Fliegen! Eine Klappe!«
Als dieses Buch 2018 erschien und wenig später auch auf Deutsch vorlag, wurde es in der Hauptsache damit beworben, dass es eine der letzten Affären von Philip Roth beschreibe. Da ich gegen solch voyeuristische Projekte eine gesunde Abneigung hege und die ersten Seiten mein Vorurteil noch bestärkten, habe ich es an mir vorübergehen lassen. Nun sind zwei Biographien über Roth erschienen, weshalb ich mich wieder an Hallidays Buch erinnert habe.
Das Text besteht aus drei Teilen: Die ersten beiden liefern jeweils ungefähr das, was heutzutage von der holzverarbeitenden Industrie als Roman ausgeschrieen wird, wobei diese beiden Teile motivisch sorgsam miteinander verknüpft sind; der dritte Teil enthält ein kurzes fiktives Radio-Interview mit dem männlichen Protagonisten des ersten Teils, Ezra Blazer. Er dient in der Hauptsache dazu, Blazer eine Biographie zu verpassen, die deutlich von der Roth’ abweicht, und außerdem vorzuführen, dass er auch mit 78 Jahren immer noch versucht, alles ins Bett zu kriegen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Der erste Teil – gut 130 Seiten – beschreibt etwa drei Jahre Beziehung zwischen der 27-jährigen Alice Dodge, Lektorin in einem New Yorker Verlag, und dem weltberühmten, 70-jährigen Autor Ezra Blazer. Nachdem Blazer Alice im Central Park angesprochen hat, kommt es sehr rasch und ohne besondere Präliminarien zu einer Affäre zwischen beiden, die über die beschriebene Zeit immer enger und partnerschaftlicher wird. Alice nimmt von Anfang an Geschenke von Ezra entgegen, auch Geld für Kleidung oder eine Klimaanlage für ihr Apartment. Am Ende verbringt sie auch längere Zeit mit Ezra in dessen Insel-Refugium, in das er sich immer wieder zum Schreiben zurückzieht, lernt schließlich auch seine Familie kennen etc. pp. Die anfangs von beiden Seiten mit bewusster Distanz geführte Beziehung wird deutlich emotionaler, bis zum Schluss des ersten teils Alice einen emotionalen Zusammenbruch hat, als sie sich mit der Sterblichkeit Ezras, die durchgehend Thema des Textes ist, ganz unmittelbar konfrontiert sieht.
Der zweite Teil ist etwa gleich lang wie der erste und präsentiert offensichtlich einen Text, den die Schriftstellerin Alice Dodge verfasst hat. In seinem Mittelpunkt steht ein junger irakisch-amerikanischer Mann, der im Jahr 2009 von Los Angeles aus zu seinem Bruder in den Irak reisen will und beim Umsteigen in London am Flughafen von der Zollbehörde festgehalten wird. Amar Ala Jaafari hat sowohl die us-amerikanische als auch die irakische Staatsangehörigkeit; er hat in den USA gerade seine Dissertation als Wirtschaftswissenschaftler abgeschlossen und sehnt sich danach, endlich wieder seinen Bruder und dessen Familie zu besuchen. Er hatte geplant, in London zwei Tage mit einem befreundeten Journalisten verbringen, doch wird er bei der Ankunft festgehalten und ausführlich befragt; nach einiger Wartezeit wird ihm die Einreise nach Großbritannien ohne eine genaue Begründung verweigert. Immerhin darf er die Nacht im Flughafen verbringen, um am nächsten Tag Richtung Irak weiterreisen zu können. Diese Episode dient als Rahmen für eine Erzählung des Lebens Amars und seiner Familie. Sein älterer Bruder, der in den USA nie heimisch geworden ist, lebt inzwischen als Arzt im Nord-Irak; der Großteil der Familie lebt aber noch immer in Bagdad, und ihr Leben während und nach der amerikanischen Eroberung des Iraks durch die US-Amerikaner ist eines der bedeutenden Themen dieses zweiten Teils.
Abgeschlossen wird der Roman, wie schon gesagt, durch ein kurzes Interview der BBC mit Ezra, dessen Funktion oben schon kurz beschrieben wurde. Der gesamte Roman ist motivisch gut gearbeitet, er ist thematisch reich und mit bedeutender Souveränität konstruiert. Für einen Erstling ein erstaunlich objektives Buch, das sehr bewusst mit Distanz zu seinen Themen und den Distanzen zwischen seinen Figuren arbeitet. Es ist auch vollständig ohne den mitgelieferten voyeuristischen Schlüssel zu lesen und zu goutieren und durchweg auf der Höhe des von ihm verarbeiteten Stoffs. An den wenigen Stellen, die ich geprüft habe (ausschließlich im ersten Teil, die als Leseprobe greifbar ist), hat sich die Übersetzung bewährt.
Lisa Halliday: Asymmetrie. Aus dem Englischen von Stefanie Jacobs. btb 71958. München: btb, 2020. Broschur, 316 Seiten. 11,99 €.