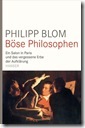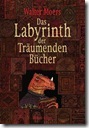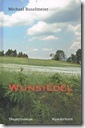Unerträglich, aber schön.
 Eine der beeindruckendsten, intensivsten Lektüren der letzten Jahre! Schalanskys Roman ist motivisch höchst kompakt und die meisten ihrer Sätze von meisterhafter Ambiguität. Oft will man nicht einen Satz oder Absatz, sondern gleich die ganze Seite mit einem Ausrufezeichen versehen!
Eine der beeindruckendsten, intensivsten Lektüren der letzten Jahre! Schalanskys Roman ist motivisch höchst kompakt und die meisten ihrer Sätze von meisterhafter Ambiguität. Oft will man nicht einen Satz oder Absatz, sondern gleich die ganze Seite mit einem Ausrufezeichen versehen!
Erzählt wird etwa ein halbes Jahr aus dem Leben von Inge Lohmark (der Name erinnert nicht zufällig an Jean-Baptiste de Lamarck), einer 55-jährigen Lehrerin für Biologie und Sport an einem Gymnasium in einer kleinen, vorpommerschen Kreisstadt. Dem Charles-Darwin-Gymnasium steht die Schließung bevor, da keine ausreichende Anzahl von Schülern mehr vorhanden ist. Die von Inge Lohmark in Biologie unterrichtete 9. Klasse ist die letzte, die an dieser Schule Abitur machen wird. Inge Lohmark ist in der DDR aufgewachsen und ausgebildet worden und betrachtet die Gegend als ihre Heimat, die sie nicht verlassen will. Sie ist in zweiter Ehe verheiratet mit Wolfgang, einem ehemaligen Veterinär-Techniker, der sich erfolgreich mit einer Straußenzucht selbstständig gemacht hat. Sie hat eine Tochter, Claudia, 35 Jahre alt, die in den USA studiert hat und seitdem dort lebt. Claudia heiratet im Verlauf der Erzählung einen ihrer Mutter unbekannten Mann, wovon sie ihr nachträglich per E-Mail Nachricht gibt. Die Ehe der Lohmarks besteht nur noch pro forma; die Eheleute sehen sich kaum, reden noch weniger miteinander, und Inge Lohmark würde sich wohl von ihrem Mann trennen, wenn sie bereit wäre, darüber länger als zehn Sekunden nachzudenken. Inge Lohmark hatte vor unbestimmter Zeit eine Affäre, aus der eine Schwangerschaft resultierte; sie hat das Kind abgetrieben. Aber auch damit kann sie sich weder intellektuell noch emotional angemessen auseinandersetzen.
Inge Lohmarks Leben ist der Unterricht. Sie ist eine strenge und kaltherzige Lehrerin, die ihre Schüler mit wenigen Ausnahmen für Versager, Idioten und Faulpelze hält; und auch die wenigen Ausnahmen gehen ihr auf die Nerven. Lohmarks Denken und Handeln scheint gänzlich bestimmt von ihrer evolutionstheoretischen Ideologie: Das Leben ist ein Kampf, in dem man sich durchzusetzen hat oder zu Recht untergeht. Sie betrachtet Schüler als »natürliche Feinde«, glaubt nicht an Liebe (»ein scheinbar wasserdichtes Alibi für kranke Symbiosen«; »Mutterliebe, das war ein Hormon. Ein Mythos«), stattdessen an Dominanz und die Nützlichkeit von Überforderung. Sie ist eine Rassistin und hält AIDS für eine geniale Strategie der Natur, um mit den Homosexuellen aufzuräumen. Sie hält »die Wahrheit« für zumutbar. Ihre Welt ist aufgeteilt zwischen Gewinnern und Verlierern:
Ihr hatte er [Schulrektor Kattner] verbieten wollen, im Sport die Verlierer an die Tafel zu schreiben. Aber wer sonst sollte nach dem Unterricht die Matten und Geräte wegräumen?
Doch in diesem Panzer aus Ideologie und emotionaler Kälte gibt es Lücken: Lohmark ist an einer ihrer Schülerinnen, Erika, auffällig interessiert. Über Erika macht sie sich Gedanken, findet sie »schön«, überlegt, warum das stille Mädchen wohl so ist, wie es ist, betrachtet es beinahe als Individuum. Dieses Interesse gipfelt in einer der merkwürdigsten Passagen des Buches: Als der Schulbus auf der Stecke, die auch Lohmark morgens mit dem Auto zurücklegt, liegen bleibt, holt sie Erika an ihrer Haltestelle ab und nimmt sie mit zur Schule. Auf dem Weg hat Lohmark plötzlich eine Phantasie von Kindesentführung und sexuell getönter Gewalt, die für einen kurzen Moment wie in einem Schlaglicht ihre sonst unter Kontrolle gehaltene Emotionalität sichtbar werden lässt. Auch Lohmarks Kindheitserinnerungen und ihre Klage über die Abwesenheit ihrer Tochter machen deutlich, dass diese Figur bei weitem nicht so eindimensional unmenschlich ist, wie sie sich selbst gerne sehen möchte. Sie ist im Gegenteil eine tief verletzte Persönlichkeit, die zudem befürchtet, an ihren eigenen ideologischen Standards gemessen eine der Verliererinnen zu sein.
Ein stehendes Gewässer. Kein Zugang zum Meer. Brackwasser stinkt.
Die Handlung gipfelt schließlich darin, dass der Rektor der Schule Lohmark dafür verantwortlich macht, dass sie sich nicht um eine von ihren Mitschülern gemobbte Schülerin gekümmert hat. Der Rektor hat die Schülerin in der Toilette eingesperrt gefunden; Lohmark hatte ihr Fehlen nicht einmal bemerkt. Es ist wahrscheinlich, dass der Rektor diesen Vorfall dazu nutzen wird, Lohmark vorzeitig aus dem Lehrerkollegium zu entfernen.
»Das Klima in deiner Klasse ist total vergiftet. Ich hätte wissen müssen, dass du nicht die Richtige dafür bist. Stand ja alles in dem Bericht. Kreidelastiger Unterricht. Mangelhafte Sozialkompetenz. Verknöcherte Persönlichkeit. Aber ich hab gedacht, altes Eisen ist nun mal hart, hab mich sogar dafür eingesetzt, dass du doch noch bis zum Schluss hierbleiben kannst. Aber jetzt hört der Spaß auf. Das wird Konsequenzen haben.«
Die personal erzählte Geschichte wird auf weiten Strecken vom Gedankenstrom Inge Lohmarks getragen. Es ist kein kleines Kunststück, eine solch unsympathische und jegliche Identifikation des Lesers abweisende Figur dominierend ins Zentrum eines Romans zu stellen, ohne sie zur Karikatur oder Parodie verkommen zu lassen. Inge Lohmark wird bei den meisten Lesern Widerwillen und Verachtung hervorrufen, hoffentlich aber auch ein wenig Mitleid mit ihr, denn sie hat es nicht verdient, so behandelt zu werden, wie sich sich selbst und ihre Mitmenschen behandelt. Niemand hat das verdient. »Der Hals der Giraffe« ist ein sehr präzises und zugleich erzählerisch schlankes Porträt eines ungeliebten, verbitterten Menschen. Mich hat es in jedem einzelnen Satz überzeugt, was ich von wenigen Büchern zu sagen vermag. In ihrer Intensität und Konsequenz kann ich Schalanskys Prosa auf Anhieb nur der von Thomas Bernhard vergleichen. Und das ist eines der größten Komplimente für einen Schriftsteller, das ich machen kann.
Bleibt zu ergänzen, dass das Buch auch in Typographie und Ausstattung aus der gewöhnlichen Ware heraussticht: ein sorgfältiger und ausgewogener Schriftsatz (von der Autorin selbst erstellt), lebende Kolumnentitel, zahlreiche, wundervolle Illustrationen, Fadenheftung und ein bedruckter Leineneinband. Da kann ich nur einmal mehr Lichtenberg zitieren :
Wer zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch an.
Judith Schalansky: Der Hals der Giraffe. Bildungsroman. Berlin: Suhrkamp, 2011. Bedrucktes Leinen, Fadenheftung, 222 Seiten. 21,90 €.
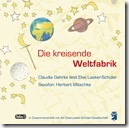 Else Lasker-Schüler ist in meiner Lektürehistorie eine regelmäßig wieder auftauchende Verbindungsperson zwischen den unterschiedlichsten Bereichen: Die Freundschaften mit Gottfried Benn und Karl Kraus zeichnen sie ebenso aus wie die mit Franz Marc und nicht zuletzt ihr verwandtschaftliches Verhältnis zum Schachweltmeister Emanuel Lasker, dessen Schwägerin sie war. Entgegen all diesen Anknüpfungspunkten bin ich über eine oberflächliche Bekanntschaft mit ihrem Werk bislang nie hinaus gekommen, und das nicht, weil mir das wenige, das ich kenne, missfallen hätte – im Gegenteil. Und dennoch blieb sie immer am Rand des Lesegangs.
Else Lasker-Schüler ist in meiner Lektürehistorie eine regelmäßig wieder auftauchende Verbindungsperson zwischen den unterschiedlichsten Bereichen: Die Freundschaften mit Gottfried Benn und Karl Kraus zeichnen sie ebenso aus wie die mit Franz Marc und nicht zuletzt ihr verwandtschaftliches Verhältnis zum Schachweltmeister Emanuel Lasker, dessen Schwägerin sie war. Entgegen all diesen Anknüpfungspunkten bin ich über eine oberflächliche Bekanntschaft mit ihrem Werk bislang nie hinaus gekommen, und das nicht, weil mir das wenige, das ich kenne, missfallen hätte – im Gegenteil. Und dennoch blieb sie immer am Rand des Lesegangs.