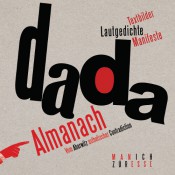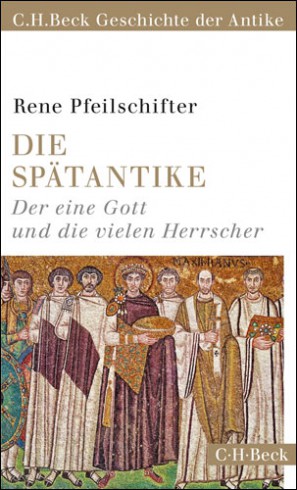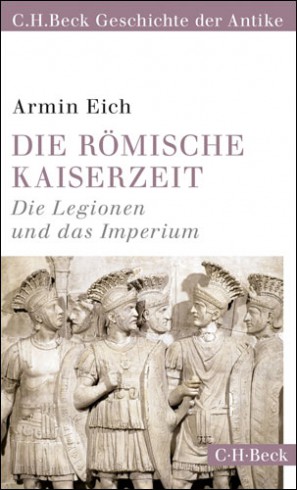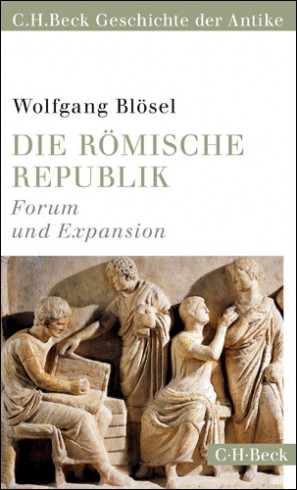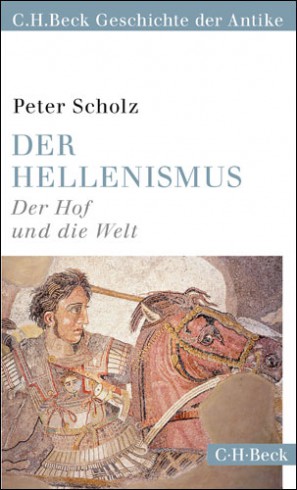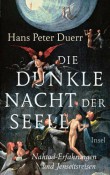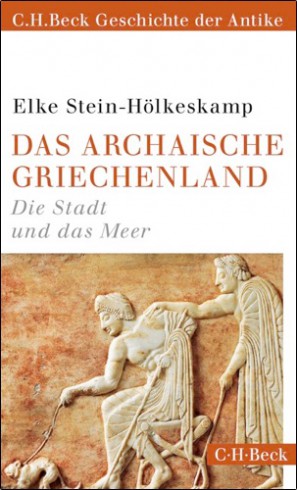Bald […] werden die Herbstbilder Pegasus, Fische und Walfisch gut zu sehen sein. Und in dem Walfisch ist der [τ] Cet, der unserer Sonne so ähnlich sein soll, weil auch er Planeten hat. Vielleicht das wahre Utopia, ohne angemaßte Herrschaft, ohne unnötiges Leid, das würde schon reichen.
 Ein außergewöhnlich gut konstruierter und detailreicher Roman über den Abschied von den Idealen der 68er-Studentbewegung; für die eine oder den anderen dürfte er vielleicht sogar ein wenig zu konstruiert sein. Der Ich-Erzähler Thomas, ein Alt-68er, der im bürgerlichen Leben nie recht Fuß gefasst hat, liegt buchstäblich auf der Straße, die er bei Rot überquert hatte, weshalb er angefahren wurde. Wahrscheinlich stirbt er während des Erzählens und färbt mit seinem Blut die Straße unter sich; neben ihm liegt ein Päckchen Sprengstoff, das gerade aus seiner Aktentasche gefallen ist.
Ein außergewöhnlich gut konstruierter und detailreicher Roman über den Abschied von den Idealen der 68er-Studentbewegung; für die eine oder den anderen dürfte er vielleicht sogar ein wenig zu konstruiert sein. Der Ich-Erzähler Thomas, ein Alt-68er, der im bürgerlichen Leben nie recht Fuß gefasst hat, liegt buchstäblich auf der Straße, die er bei Rot überquert hatte, weshalb er angefahren wurde. Wahrscheinlich stirbt er während des Erzählens und färbt mit seinem Blut die Straße unter sich; neben ihm liegt ein Päckchen Sprengstoff, das gerade aus seiner Aktentasche gefallen ist.
Beruflich ist Thomas Grabredner, einer jener, die gebeten werden, in den Fällen über dem Toten zu sprechen, wenn keine der Konfessionen sich als zuständig betrachtet oder vom Toten gern gesehen würde. Und so hält Thomas in seinen letzten Minuten auf Erden eine Grabrede auf sich und seine ehemaligen Freunde aus der Studentenbewegung: Zum Beispiel Edmond und Vera, die aus der Frankophilie Edmonds einen lukrativen Weinimport gemacht und sich als neureiche Alkoholiker in einer Neubau-Villa niedergelassen haben. Die Ehe kriselt, Vera ist im Entzug, Edmond sitzt im von seiner Frau leergeräumten Haus, säuft Wein aus dem Suppenteller und schlägt seinen Kopf vor die Wand. Oder Krause, der mit Lisa, einer Norwegerin, in Mecklenburg-Vorpommern in ländlicher Idylle mit Streuselkuchen und Schlagsahne lebt. Beide sind Lehrer, und Krause betreibt nebenbei ein Antiquariat, das auf die Theorie der Studentenrevolution spezialisiert ist.
Am wichtigsten aber ist Aschenberger, der gerade verstorben ist und Thomas testamentarisch als seinen Grabredner verpflichtet hat. Auch Aschenberger scheint sich bürgerlich etabliert zu haben – er hat bei seiner Heirat den Namen seiner Frau angenommen und heißt nun Lüders. Er verdient sein Geld mit alternativen Stadtführungen durch Berlin, lebt in einer mit Büchern vollgestopften Wohnung und plant einen letzten großen Coup: Er will die Berliner Siegessäule als Symbol der missratenen deutschen Geschichte in die Luft sprengen und sich anschließend der Polizei stellen. Aus seinem Nachlass stammt der Sprengstoff, der Thomas bei seinem Unfall aus der Tasche gefallen ist.
Die Wiederbegegnung mit Aschenberger setzt Thomas sichtlich zu, der selbst sich vor einigen Jahren nach einer Midlife-Crisis radikal von der eigenen Vergangenheit getrennt hat, in dem er allen persönlich Besitz verkauft oder weggeworfen hat und seitdem in einer kargen Wohnung sein Leben von Tag zu Tag verbringt. Doch sein unreligiöses Mönchstum wird derzeit heftig gestört: Thomas hat eine Affäre mit der verheirateten Iris, die eine Generation jünger ist als er. Iris ist Bühnenbildnerin und Lichtgestalterin, sie lebt also davon, ästhetische Illusionen zu verkaufen. Die Affäre spitzt sich kurz vor Thomas Unfall zu, als Iris schwanger wird, ihren Mann Ben verlässt und mit Thomas eine Familie gründen will. Ihre offene Emotionalität überwältigt Thomas immer mehr, der kurz davor steht, sich auf Iris Pläne einzulassen, als der Unfall all dem ein Ende setzt.
Außer dieser Hauptlinie der Erzählung glänzt der Roman mit zahlreichen weiteren Nebenfiguren und Kleinsterzählungen, etwa der depressiven Animateurin Tessy, der politisch engagierten Türkin Nilgün oder dem Maler Horch – wahrscheinlich der spannendsten Figur im ganzen Roman. Man findet heute nur wenige Erzähler, die tatsächlich soviel zu erzählen haben und denen es gelingt, ihre divergierenden Stoffe dennoch auf die großen literarischen Themen – Tod, Liebe, Geburt – zu fokussieren, ohne dass es peinlich wird. Ein wirklich gelungenes Stück!
Uwe Timm. Rot. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2001/2005. Bedruckter Pappband, 428 Seiten. 15,– Euro. (Auch als dtv-Taschenbuch lieferbar.)