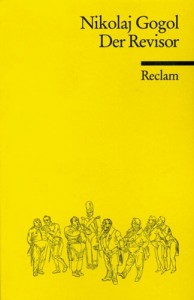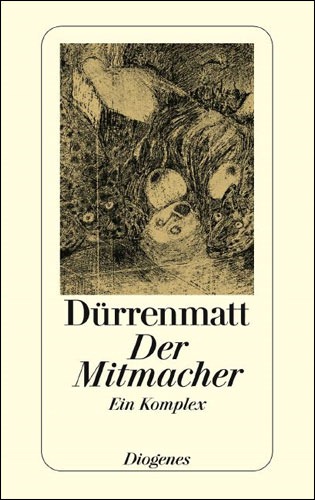Ich fürcht, ich fürcht, ’s wird rundgehn mit der Welt.
 König Richard III. ist bekanntlich jener dialektische Tyrann, den es brauchte, um den englischen Sturz aus der politischen Unschuld in den Rosenkrieg so auf die Spitze zu treiben, dass er überwunden werden konnte. Nach ihm erschien jede Herrschaft annehmbarer und sei es die eines Heinrich VII. Und so sind Richards Tyrannei, seine moralische wie körperliche Verwachsenheit zentrale Elemente jenes Tudor-Mythos, der zur Rechtfertigung und Sicherung der Herrschaft seiner Nachfolger diente. Und Shakespeares Stück ist nur eine theatralische Verlängerung und dramaturgische Verwertung jenes Mythos.
König Richard III. ist bekanntlich jener dialektische Tyrann, den es brauchte, um den englischen Sturz aus der politischen Unschuld in den Rosenkrieg so auf die Spitze zu treiben, dass er überwunden werden konnte. Nach ihm erschien jede Herrschaft annehmbarer und sei es die eines Heinrich VII. Und so sind Richards Tyrannei, seine moralische wie körperliche Verwachsenheit zentrale Elemente jenes Tudor-Mythos, der zur Rechtfertigung und Sicherung der Herrschaft seiner Nachfolger diente. Und Shakespeares Stück ist nur eine theatralische Verlängerung und dramaturgische Verwertung jenes Mythos.
Selbstverständlich ist eine durch und durch böse Figur von besonderem Reiz, zeigt sie doch die Vorzüge der Macht einmal unverstellt und beflügelt so die Phantasie derer, die selbst heimlich oder unheimlich von ihr träumen. Und so gerät Richard denn auch: Beredt, charmant, beliebt bei Kindern, erfolgreich selbst bei Frauen, deren Ehemänner er kurz zuvor noch ermordet hat, öffentlich fromm, privat gottlos, Solidaritäten einfordernd, selbst aber verweigernd – und alle, die ihm widersprechen, werden einfach hingerichtet. Was für ein angenehmes Leben!
Natürlich kann man solche unverstellte Selbstherrlichkeit nicht auf sich beruhen lassen, und das Schicksal schreitet rasch: Einige entkommen dem Zugriff des Tyrannen und wollen selbst Kalif sein anstelle des Kalifen. Was macht man unter Männern, wenn man sich über den Zugang zur Macht nicht einig wird? Man führt Krieg. Und in dem hat Richard das Pech, erschlagen zu werden und so sein historisches Porträt von den Siegern geschrieben zu bekommen. Wahrscheinlich war er in Wirklichkeit nicht bucklig, nur halb so bös und kaum viertels so beredt.
Shakespeare hat in „König Richard III.“ hauptsächlich mit einem Mangel an echter Handlung und Entwicklung zu kämpfen. Die Handlung setzt kurz vor dem Tod Edward IV. ein: Richard beseitigt seinen Bruder George, der ein möglicher Konkurrent bei der Thronfolge wäre, aber leider gelingt dies ohne viel Aufwand. Edward stirbt kurz darauf von selbst und anschließend muss nur der Thronerbe in den Tower gesperrt werden, damit die eigene Thronfolge mit geringem Aufwand inszeniert werden kann. Richards Streben nach der Macht wird zwar oft und wortreich beklagt, aber niemand leistet effektiven Widerstand. Der letzte Akt liefert dann endlich eine Schlacht, aber bis dahin ist nur wenig zu tun.
Auch kann von keiner Entwicklung des Protagonisten gesprochen werden: Seine Intentionen sind von der ersten Szene an so eindeutig und langweilig offenbar, dass von daher kaum irgendeine dramaturgische Bewegung erhofft werden kann. Shakespeare hilft sich heraus, indem er zahlreiche Szenen einbaut, in denen andere über Richard und die fatalen Folgen seines Strebens zur Macht klagen. Es ist ihm dabei zugute zu halten, dass es unter all denen, die Richard beschuldigen, keinen gibt, die oder der selbst frei von Schuld wäre; hier sitzt ein jeder, der Steine wirft, im eigenen Glashaus. So geht’s halt zu bei Königs daheim.
Ein Stück, das nahezu ausschließlich von der Faszination am unverstellten Bösen und dem Charakter des Protagonisten lebt. Wer Tyrannen, ihr Wirken, Meinen und Leiden eher nebensächlich oder weniger interessant findet, mag sich langweilen. Für alle, die glauben, die Macht könne sie oder gar uns erretten, eine Art Lehrstück. Am wirkungsvollsten in Diktaturen aufzuführen.
William Shakespeare: König Richard III. Übersetzt von Frank Günther. Zweisprachige Ausgabe. Gesamtausgabe Bd. 11. Cadolzburg: ars vivendi, 2002. Geprägter Leineneinband, Fadenheftung, zwei Lesebändchen, 376 Seiten. 33,– €.