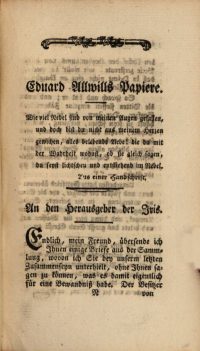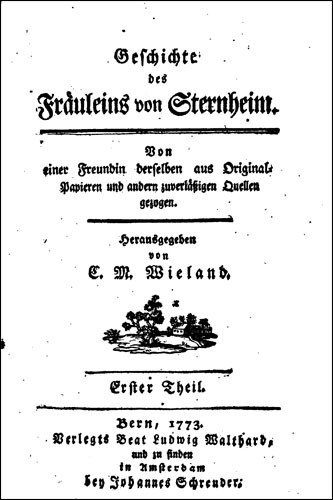Friedrich Heinrich Jacobi (1743–1819) ist einer jener Schriftsteller des Übergangs vom 18. zum 19. Jahrhundert, die nur deshalb noch einigermaßen in Erinnerung sind, weil sie sich in die reiche Briefkultur dieser Zeit eingeschrieben haben. Jacobis älterer Bruder war der als Dichter oft verspotteter Anakreontiker Johann Georg Jacobi, der an zahlreichen Zeitschriften der Zeit beteiligt war und dessen Prominenz seinem Bruder den Weg zu zahlreichen berühmteren Korrespondenzpartnern eröffnete. Ganz im Geiste der Zeit folgten den Briefen auch persönliche Begegnungen, und so wurde Friedrich Heinrich Jacobi eine der vielen Randfiguren der deutschen Literarhistorie.
Die ersten Briefe Aus Eduard Allwills Papieren erschienen 1775 in der von Johann Georg Jacobi herausgegebenen Zeitschrift Iris, die sich explizit an ein weibliches Publikum wandte. Fortgesetzt wurde die Reihe der Briefe dann 1776 in Wielands Teutschem Merkur und dann über weitere Zwischenstufen bis 1812, als sie als Allwills Briefsammlung innerhalb der vom Autor selbst besorgten Werke endgültig fixiert wurden. Die Reihe von Briefen einen Roman zu nennen, wie dies weitgehend geschieht, ist etwas verwegen, nicht nur wegen des mäßigen Umfangs, sondern auch, weil eine Handlung eher angedeutet ist, als dass sie wirklich erzählt würde.
Die Briefe erzählen im im Großen und Ganzen eine Episode aus der Geschichte der Familien Clerdon und der mit ihr verschwägerten von Wallberg, zu deren Bekanntenkreis auch der titelgebende junge Eduard Allwill gehört. Allwill hat sich bereits in seiner Kindheit als ein besonders willensstarkes und eigensinniges Kind gezeigt und ist nun ein junger Mann, der auf gesellschaftliche Usancen nur wenig Rücksicht nehmen zu müssen glaubt. Er hat offensichtlich einer jungen Frau – Luzie von Wallberg – den Kopf verdreht und sie dann sitzen lassen. In einem ihrer Briefe schreibt ihre Tante Silly:
So ward unsere Luzie hingewagt, so ging uns das süße Geschöpf verloren; denn sie stirbt, Kinder, und ihr Tod ist dieser Allwill!
Als ganz so dramatisch erweist sich die Lage dann doch nicht: In den beiden letzten Briefen, die das eigentliche Prunkstück der Sammlung (1775/1776) bilden, verbreitet Eduard nicht nur seine libertinistische Philosophie des natürlichen Gefühls, dem es zu folgen gelte, sondern er erhält auch eine vollständige Zurückweisung seines Standpunktes durch die bürgerlich-moralisch argumentierende Luzie, die mit ihrem Plädoyer das letzte Wort behält. Einen sterbenden Eindruck macht sie dabei ganz und gar nicht.
Ich bin an dieses Stück geraten, da ich im Rahmen einer Rezension, die hier nichts zur Sache tut, wieder einmal den Goetheschen Werther in die Hand genommen habe und dabei an Jacobi erinnert wurde, von dem mir bislang nur sein Woldemar dem Namen nach bekannt war. Der Eduard Allwill stand kurzzeitig im Verdacht eine weiterer Briefroman aus der Feder Goethes zu sein, wenn dies auch aus einer eher oberflächlichen Vergleichung mit dem Werther herzurühren scheint. Da das Stück rasch gelesen ist (digitale Texte und deren Ausdrucke finden sich zuhauf), kann ich es für jene, die an der Literatur der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang interessiert sind, nur empfehlen. Wahrscheinlich werde ich hier in nächster Zeit noch die eine oder andere kleine Publikation, die im zeitlichen Umfeld des Werthers entstanden ist, besprechen.
Friedrich Heinrich Jacobi: Aus Eduard Allwills Papieren. Düsseldorf: Iris 4.1775 und Weimar: Der Teutsche Merkur 2.1776–4.1776.