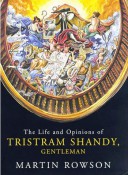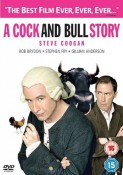… des Professor von Igelfeld ist ein Sammelband der drei kleine Büchlein zusammenfasst, deren gemeinsamer Held der im deutschen Titel genannten Professor Dr. Moritz-Maria von Igelfeld ist. Leider ist der Titel insoweit etwas irreführend, als Professor Dr. Igelfeld keinerlei verschmähte Schriften geschrieben hat und dementsprechend der Band weder solche enthält noch von ihnen zu berichten weiß. Offensichtlich hat sich der deutsche Verlag gescheut, den englischen Sammeltitel The 2½ Pillars of Wisdom zu übernehmen, offenbar weil Lawrences Sieben Säulen der Weisheit den deutschen Lesern nicht mehr präsent genug sind, um die Pointe auszulösen. Das ist allerdings schon der einzige Einwand, der sich gegen die deutsche Ausgabe erheben lässt. Nicht nur ist der Band in einem leichten und angenehmen Stil übersetzt, der Verlag hat sich auch entschlossen, die Illustrationen von Iain McIntosh abzudrucken.
… des Professor von Igelfeld ist ein Sammelband der drei kleine Büchlein zusammenfasst, deren gemeinsamer Held der im deutschen Titel genannten Professor Dr. Moritz-Maria von Igelfeld ist. Leider ist der Titel insoweit etwas irreführend, als Professor Dr. Igelfeld keinerlei verschmähte Schriften geschrieben hat und dementsprechend der Band weder solche enthält noch von ihnen zu berichten weiß. Offensichtlich hat sich der deutsche Verlag gescheut, den englischen Sammeltitel The 2½ Pillars of Wisdom zu übernehmen, offenbar weil Lawrences Sieben Säulen der Weisheit den deutschen Lesern nicht mehr präsent genug sind, um die Pointe auszulösen. Das ist allerdings schon der einzige Einwand, der sich gegen die deutsche Ausgabe erheben lässt. Nicht nur ist der Band in einem leichten und angenehmen Stil übersetzt, der Verlag hat sich auch entschlossen, die Illustrationen von Iain McIntosh abzudrucken.
Professor Dr. Moritz-Maria von Igelfeld ist Autor des weltberühmten, grundstürzenden, mehr als 1200 Seiten umfassenden Werkes Portugiesische unregelmäßige Verben, das nicht nur Igelfelds wissenschaftliche Reputation begründet hat, sondern auch den Dreh- und Angelpunkt all seines Selbstbewusstseins darstellt. Und davon hat er nicht zu wenig. Allerdings muss er feststellen, dass seine Mitmenschen nicht immer in der Lage sind, sich Igelfelds Rang und persönlicher Bedeutung – er ist sogar fast ein Baron – angemessen zu verhalten. Deshalb sind auch seine beiden Kollegen Professor Dr. Dr. h. c. Florianus Prinzel (den Igelfeld heimlich beneidet) und Professor Dr. Detlev Amadeus (von) Unterholzer, die zusammen mit ihm romanische Philologie an der Universität von Regensburg lehren, die wichtigsten Bezugspersonen seines Lebens, weil er bei Ihnen sicher sein kann, dass sie ihm nicht nur in Neid und Bewunderung treu verbunden sind, sondern auch seine spezifische Art der Weltfremdheit (man nennt das wohl gemeinhin einen Wertekanon) teilen.
Er konnte sich vorstellen, dass das Leben eines Diplomaten oder selbst eines Schismatikers fast so spannend sein konnte wie das eines Professors für romanische Philologie. Fast, aber nicht ganz.
Diese Clique deutscher Philologen wird nun vom Autor mehr oder weniger gemeinsam in der Welt herumgetrieben und machen dort die mehr oder weniger unvermeidlichen Erfahrungen. Das ganze steht offensichtlich in der Tradition der Prosakomödien P. G. Wodehouses, nur eben ins späte zwanzigste Jahrhundert und die Schicht der deutschen intellektuellen Snobs verpflanzt. Dabei lässt McCall Smith den deutschen intellektuellen Snobs insoweit Gerechtigkeit wider- fahren, als während eines Gastsemesters Igelfelds in Cambridge eine Auswahl englischer intellektueller Snobs als Folie dient.
Eine höchst vergnügliche Lektüre, die nur diejenigen meiden sollten, denen der Gedanke der Misshandlung von Dackeln schwer erträglich ist.
Alexander McCall Smith: Die verschmähten Schriften des Professor von Igelfeld. Aus dem Englischen von Thomas Stegers. München: Karl Blessing, 2007. Pappband, 448 Seiten. 19,95 €.