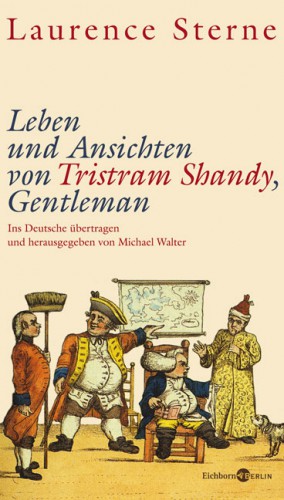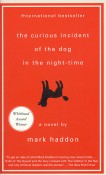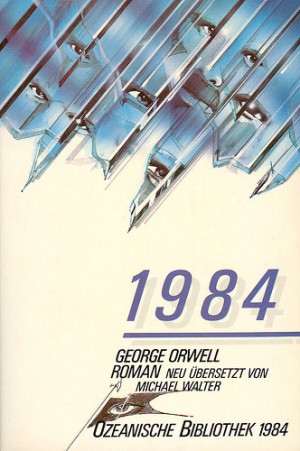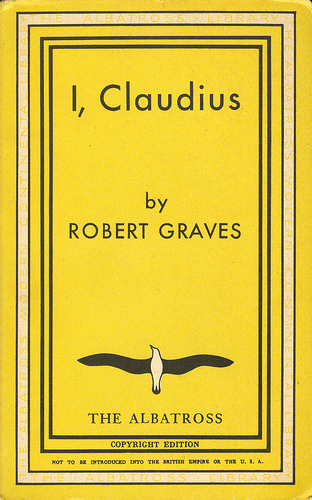Ein in mehrfacher Hinsicht merkwürdiges Buch: Es ist der umfangreichste Text von Lewis Carroll und wahrscheinlich auch einer seiner ungelesensten. Arno Schmidt hat das Buch sehr gelobt und an ihm seine These demonstriert, dass es sich bei Carroll um den »Kirchenvater aller modernen Literatur« handele, was nur eine knollige Ansicht mehr ist.
Ein in mehrfacher Hinsicht merkwürdiges Buch: Es ist der umfangreichste Text von Lewis Carroll und wahrscheinlich auch einer seiner ungelesensten. Arno Schmidt hat das Buch sehr gelobt und an ihm seine These demonstriert, dass es sich bei Carroll um den »Kirchenvater aller modernen Literatur« handele, was nur eine knollige Ansicht mehr ist.
Für Arno Schmidt war das Buch wichtig, weil es ein Beipiel für das ist, was er ein »Längeres Gedankenspiel« nennt. Carroll konstruiert in »Sylvie und Bruno« einen Doppelroman, dessen beide Ebenen über den Ich-Erzähler miteinander verbunden sind: Auf der »Realitäts«-Ebene ist es eine Liebesgeschichte zwischen Arthur, einem jungen Freund des Ich-Erzählers, und Lady Muriel, die einander nach längeren Umständen endlich finden, dann wieder verlieren usw. usf. Ich will nicht zuviel verraten, wenn auch alles sehr vorhersehbar konstruiert ist. Spannend wird das Buch aber dadurch, dass der Erzähler regelmäßig in »irrliche« Zustände gerät, in denen er teils Beobachter, teils Mitspieler einer Elfenwelt ist, deren Protagonisten die Geschwister Sylvie und Bruno sind. Sylvie ist Brunos ältere Schwester, vielleicht 12 oder 13 Jahre alt, während Bruno noch ganz phantastisches Kind ist. Auf dieser zweiten Ebene herrschen ausgelassene Phantastik und Wortwitz, während die »Realität« des Romans zunehmend altbacken moralischer und bis an die Grenze des Erträglichen religiös durchtränkt wird.
Noch in einer weiteren Hinsicht ist das Buch merkwürdig zu nennen, denn obwohl es alles andere als bekannt ist, hat es seit 1980 gleich zweieinhalb Übersetzungen dieses Textes gegeben. Im Jahr 1980 erschien nämlich beim Robinson Verlag der erste Band des auch im Englischen zweibändigen Werkes in einer Übersetzung von Michael Walter. Sie trägt den ein wenig schmidtsch anmutenden Titel »Sylvie & Bruno. Eine Historie« und hat die weitere Merkwürdigkeit, dass gemäß Arno Schmidts Vorstellung vom »Längeren Gedankenspiel« die beiden Ebenen des Buches auch drucktechnisch kenntlich gemacht wurden: Behandelt der Text die »Realität«, so rückt der Textblock an den linken Rand der Seite, erzählt er von der Elfenwelt, so rückt er nach rechts. Das ist ohne Frage nach dem Vorbild von Schmidts Roman »Kaff auch Mare Crisium« so gestaltet worden. Offenbar war das Buch bei Robinson kein Erfolg, denn der zweite Band ist dort nie erschienen.
Einige Jahre später lieferte dann Goldmann eine vollständige deutsche Ausgabe in der Fassung Dieter H. Stündels unter dem etwas reißerischen Titel »Sylvie & Bruno. Ein phantastischer Nonsense-Roman«; mag sein, dass der Übersetzer am Untertitel unschuldig war, denn diese Übersetzung ist dann 1994 bei Häusser in Darmstadt nochmals gedruckt worden, nun allerdings mit dem ebenso frei erfundenen Untertitel »Die Geschichte einer Liebe«.
Und als sei dies alles nicht genug, hat im vergangenen Jahr dtv eine weitere Ausgabe vorgelegt, diesmal unter dem gänzlich unauffälligen Titel »Sylvie und Bruno. Eine Geschichte« und wieder in einer Übersetzung durch Michael Walter, der allerdings diesmal für die zahlreichen Gedichte des Buches auf die Mitarbeit von Sabine Hübner gebaut hat. Besonders wird diese Ausgabe durch die Tatsache, dass Walter den Text offensichtlich komplett neu übersetzt hat. Seine neue Übersetzung unterscheidet sich in Wortwahl und Duktus prägnant von der früheren, und wir haben hier den seltenen Fall, die zeitliche Verwerfung von 25 Jahren in der Entwicklung eines Übersetzers studieren zu können. Man möchte fast sagen: Schade, dass dies nicht an einem besseren Buch geschehen ist als gerade an Carrolls »Sylvie und Bruno« – aber man kann nicht alles haben.
Auch in der Neuübersetzung Walters ist das Buch für den modernen Leser nicht wirklich zu retten, wenn man einmal von eher theoretischen Annäherungen wie denen Schmidts absieht, die für Schmidts Werk sicherlich von Bedeutung sind, für den unverdorbenen unbelasteten Leser aber keine große Rolle spielen können. Die Feengeschichte des Buchs ist durchaus gelungen, und die zahlreichen Gedichte des Buches bringen die Art von Vergnügen, die man bei Carroll gewohnt ist. Was aber die »Realität« des Buches angeht, so ist sie – wie bereits angedeutet – in weiten Teilen eher hölzern und ermüdend; nur hier und da blitzt ein Gedankenspiel auf, das ahnen lässt, was Carroll möglich gewesen wäre, wenn er nicht um jeden Preis einen Roman hätte schreiben wollen. Von daher ist das Buch nur Lesern mit großer Geduld zu empfehlen oder solchen, die den Differenzen der beiden Walterschen Übersetzungen nachspüren wollen.
Lewis Carroll: Sylvie und Bruno. Eine Geschichte. Aus dem Englischen von Michael Walter und Sabine Hübner. Mit 92 Illustrationen von Harry Furniss. dtv 13289. München: dtv, 2006. 15,– €.