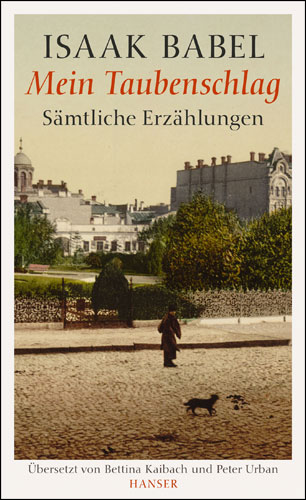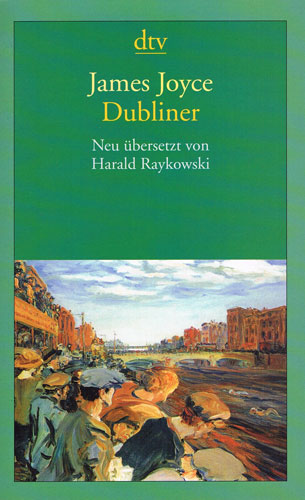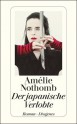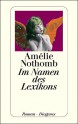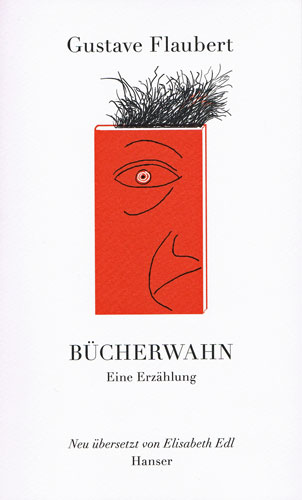»Sie tat, was sie wollte!«
 „Daisy Miller“ ist eine der frühen Erzählungen Henry James’, erstmals veröffentlicht im Jahr 1878. Das Original trägt den etwas differenzierteren Titel “Daisy Miller: A Study”, was in dieser Neuausgabe bei dtv auf die schlichte Gattungsbezeichnung „Eine Erzählung“ reduziert wird. Der Geschichte seiner Titelheldin stand James im Alter eher reserviert gegenüber, musste aber hinnehmen, dass sie zu seinen bekanntesten und beliebtesten gehörte.
„Daisy Miller“ ist eine der frühen Erzählungen Henry James’, erstmals veröffentlicht im Jahr 1878. Das Original trägt den etwas differenzierteren Titel “Daisy Miller: A Study”, was in dieser Neuausgabe bei dtv auf die schlichte Gattungsbezeichnung „Eine Erzählung“ reduziert wird. Der Geschichte seiner Titelheldin stand James im Alter eher reserviert gegenüber, musste aber hinnehmen, dass sie zu seinen bekanntesten und beliebtesten gehörte.
Interessanterweise ist der eigentliche Protagonist aber der junge US-Amerikaner Frederick Winterbourne, der bereits als Kind nach Europa gekommen ist. Zur Zeit der Erzählung lebt er in Genf, wo er vorgeblich studiert, tatsächlich aber eine Beziehung zu einer älteren Frau pflegt. Daisy Miller lernt er zufällig kennen, als er seine Tante im Kurort Vevey besucht. Sie fällt ihm sofort nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch wegen ihres sehr freien und selbstbewussten Verhaltens auf. Sie lässt sich schon nach kurzer Bekanntschaft mit Winterbourne darauf ein, zusammen mit ihm – und nur mit ihm – das nahegelegene Schloss Chillon zu besichtigen.
Winterbournes Tante reagiert auf seinen Bekanntschaft mit Daisy etwas reserviert, da sie von den Millers gesellschaftlich nicht viel hält. Daisy, die zusammen mit ihrer Mutter und ihrem viel jüngeren Bruder in Europa unterwegs ist, stammt aus einer Industriellenfamilie, die aber nicht zur High Society der USA zu rechnen ist. Für Winterbournes Tante machen sich diese Leute allein schon deshalb unmöglich, weil sie mit ihrem europäischen Cicerone zusammen essen und überhaupt einen vertrauten Umgang mit ihm pflegen. Daisy lebt in Europa offenbar ein außergewöhnlich freies Leben, da ihre Mutter sich als gänzlich unfähig erweist, der Selbstständigkeit ihrer Tochter irgendwelche Grenzen zu setzen.
Als Winterbourne seinen Besuch in Vevey bereits nach wenigen Tagen beendet, lässt Daisy für einen einzigen Moment durchblicken, dass ihr ironisches und distanziertes Spiel mit Frederick nur eine Farce ist, und sie an dem jungen Mann doch ernsthafter interessiert sein könnte. Sie nötigt ihm jedenfalls das Versprechen ab, sie im Winter in Rom aufzusuchen, was in Fredericks Pläne passt, da auch seine Tante sich dann in Rom aufhalten wird.
Winterbourne trifft etwa acht Monate später erwartungsvoll in Rom ein und hofft eine Daisy vorzufinden, die ihn sehnsüchtig erwartet. Stattdessen amüsiert sich die junge Frau prächtig in der römischen Gesellschaft, pflegt Freundschaften mit italienischen Junggesellen und kümmert sich wenig darum, was die amerikanische Gemeinde in Rom von ihr denkt. Diese Spannung kommt zur Entladung, kurz nachdem Frederick in Rom eingetroffen ist: Daisy wird von einer der Grande Dames der Amerikaner dazu aufgefordert, einen Spaziergang mit ihrem italienischen Freund Giovanelli abzubrechen und zu ihr in die Kutsche zu steigen; als Daisy sich weigert, das zu tun, wird sie bei nächster Gelegenheit öffentlich abgekanzelt und aus der guten Gesellschaft ausgestoßen.
Winterbourne reagiert in einer Mischung aus Enttäuschung, Eifersucht und Unsicherheit ebenfalls abweisend; er versucht zwar noch, Daisy auf den rechten Weg zu führen, gibt sie dann aber letztlich ebenfalls auf. James bringt die Erzählung zu einem recht abrupten Ende, indem er Daisy an der Malaria erkranken und kurz darauf sterben lässt. Am Grab kommt Frederick zur Einsicht, die junge Frau und ihre Handlungen falsch be- und sie daher verurteilt zu haben. Doch allzu tief scheint es ihn nicht getroffen zu haben, denn letztlich kehrt er zu seinem eigenen unmoralische Verhältnis in Genf zurück.
Es ist nicht ganz einfach zu bestimmen, wovon James in diesem Text eigentlich erzählt; es könnte sogar der Verdacht aufkommen, dass er das selbst nicht so ganz genau gewusst hat. Der für James typische Gegensatz zwischen nordamerikanischen und europäischen Sitten bildet nur die Folie für eine Geschichte, in der einen junge Frau von der sie umgebenden Gesellschaft dafür verurteilt und abgestraft wird, dass sie sich Freiheiten herausnimmt, die bei einem US-amerikanischen Mann in Europa selbstverständlich toleriert werden. Dass James das Thema nicht vollständig durchführen konnte, zeigt sich an dem hilfsweisen Tod Daisys, für den zum Teil ihr eigener Starrsinn, zum Teil die Leichtfertigkeit Giovanellis verantwortlich gemacht werden. Daisy scheitert an der Gefährlichkeit der Natur, der sie sich aussetzt, nicht an der Gesellschaft, von der sie verurteilt wurde. Das ermöglicht eine Tragik, für die am Ende keiner wirklich verantwortlich zeichnet, ohne dass das kritische Potenzial der Erzählung damit aufgehoben würde. Wahrscheinlich ist es diese eigentümliche Konstruktion, die zu ihrem dauerhaften Erfolg wesentlich beigetragen hat.
Die Neuübersetzung von Britta Mümmler liest sich gut und ist, soweit ich sie geprüft habe, in der Sache korrekt, nimmt sich für meinen Geschmack aber stilistisch ein wenig zu viele Freiheiten heraus – fehlende oder hinzugefügte Worte, Verwechslung von Subjekt und Objekt und andere Änderung von Satzstrukturen habe ich allein auf den ersten Seiten gefunden; den kastrierten Titel muss man wahrscheinlich dem Verlag und nicht der Übersetzerin anlasten. Wer den englischen Text nicht kennt, wird aber mit dieser deutschen Ausgabe ganz zufrieden sein; die Erläuterungen im Anhang sind gut gesetzt und hilfreich. Alles in allem eine gute deutsche Leseausgabe.
Henry James: Daisy Miller. Aus dem Englischen von Britta Mümmler. Kindle-Edition. München: dtv, 2015. (Druckausgabe: 128 Seiten.) 9,99 €.