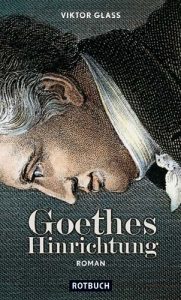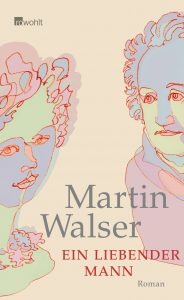Im kleinen Goethejahr 2007 hat der Aufbau Verlag das Reisetagebuch der ersten großen Reise August von Goethes nach Potsdam, Berlin, Dessau, Torgau und Dresden veröffentlicht. Die Reise fand zwischen dem 4. Mai und dem 27. Juni 1819 statt. August von Goethe reiste zusammen mit seiner Gemahlin Ottilie, die auf der Reise in der Hauptsache gedachte, ihre Verwandten zu besuchen. Für August war die Reise vom Vater als kleine Bildungsreise gedacht, aber August sollte auch für den Vater die Augen und Ohren offen halten, fleißig Bericht erstatten und schließlich zahlreiche Kontakte pflegen, die der Vater persönlich nicht aufsuchen konnte oder wollte.
Im kleinen Goethejahr 2007 hat der Aufbau Verlag das Reisetagebuch der ersten großen Reise August von Goethes nach Potsdam, Berlin, Dessau, Torgau und Dresden veröffentlicht. Die Reise fand zwischen dem 4. Mai und dem 27. Juni 1819 statt. August von Goethe reiste zusammen mit seiner Gemahlin Ottilie, die auf der Reise in der Hauptsache gedachte, ihre Verwandten zu besuchen. Für August war die Reise vom Vater als kleine Bildungsreise gedacht, aber August sollte auch für den Vater die Augen und Ohren offen halten, fleißig Bericht erstatten und schließlich zahlreiche Kontakte pflegen, die der Vater persönlich nicht aufsuchen konnte oder wollte.
Besonders in Berlin werden Ottilie und August denn auch entsprechend behandelt: Neben den verwandten, die Ottilie täglich aufsucht, um mit ihnen Zeit zu verbringen, kommen die beiden zahlreichen gesellschaftlichen Verpflichtungen nach, werden bei Gelegenheit eines Festes beim Fürsten Radziwill sogar dem König vorgestellt und allseits liebenswürdig und äußerst erfreut aufgenommen. Man redet viel mit ihnen über den Vater. In der übrigen Zeit erledigt August ein umfangreiches Besichtigungsprogramm, schreibt Berichte nach Weimar, die er aus dem regelmäßig geführten Tagebuch extrahiert. Des öfteren verweist er darauf, dass er später mündlich genaueren Bericht zu geben gedenkt; auch hierfür sollte das Tagebuch als Gedächtnisstütze dienen.
Besonders im letzten Abschnitt der Reise verändert sich deren Charakter: Dresden besucht man hauptsächlich mit touristischen Ambitionen. Hier sind keine Visiten zu erledigen und August und Ottilie unternehmen die meisten Besichtigungen und Ausflüge gemeinsam, so auch einen dreitägigen Ausflug in die Sächsischen Schweiz, den man in Begleitung mehrerer Reisebekanntschaften genießt. Gerade für Dresden empfiehlt der Vater denn auch ausdrücklich, sich Zeit zu nehmen, da dort »die Kunstwerke aller Art […] näher beysammen stehen als irgendwo und auf einem echten Grund und Boden«. Er erwirkt daher dem Sohn auch eine Verlängerung seines Urlaubs um acht Tage.
Die Herausgeberin Gabriele Radecke, die sich um August von Goethe schon mit der Mitherausgeberschaft des Italien-Tagebuchs und dem Neudruck von Wilhelm Bodes »Goethes Sohn« verdient gemacht hat, vereint in dem vorliegenden Band das eigentlich Tagebuch mit den Briefen Augusts an Goethe. Hinzukommen Briefe des Vaters an August, zahlreiche weitere Briefe von und an Ottilie von Goethe sowie einige wenige Schreiben von Reisebekanntschaften, die sich im Anschluss direkt an Johann Wolfgang von Goethe wenden. All dies ist so gut es geht in eine chronologische Ordnung gebracht. Zwar ergeben sich dadurch notwendig Doppelungen des Berichteten, was aber – da die Briefe zumeist eine geraffte Fassung des Tagebuchtextes liefern – nicht wirklich stört. Alle Texte sind nach den Handschriften ediert, wobei man nur dort behutsam in die Texte eingegriffen hat, wo es dem Leser beim Verständnis der Lektüre hilft. Der Band ist ausführlich und – wie immer bei Gabriele Radecke – kompetent kommentiert. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, die Anmerkungen parallel zum Text zu verfolgen.
Durch das breit gewählte Umfeld an Briefen von Bekannten und Verwandten gewinnt das Buch deutlich, denn gerade in die Zeit der Reise des jungen Ehepaars fällt die Finanzkrise der Familie Johanna Schopenhauers, die durch den Konkurs des Danziger Bankhauses Muhl mit dem Verlust eines Großteils ihres Vermögens bedroht ist. Adele von Schopenhauer und Ottilie von Goethe sind langjährige, innigste Freundinnen, und so erfahren wir aus Adeles überschwänglichen Briefen von der Aufregung und den immer wieder wechselnden Reiseplänen der Schopenhauers, die sich am Ende doch entschließen, nach Danzig zu fahren.
Insgesamt bietet das Buch einen lebendigen und facettenreichen Ausschnitt der Goethezeit. Man muss der Herausgeberin sicherlich nicht folgen, wenn sie bereits in den berichten und Briefen von dieser Reise die spätere Zerrüttung der Ehe der jungen Goethes wahrnehmen will. Auch erscheint mir der andeutungsweise Versuch, Ottilie aufgrund ihres während der Reise chronischen Hustens in einer Art Opferrolle zu sehen, ein wenig überspannt. Aber das geschieht aus der Rückschau vom Ende dieser Ehe her natürlich leicht. Im Großen und Ganzen erscheinen Ottilie und August im Jahr 1819 noch als ein weitgehend »normales« bürgerliches Ehepaar; sicherlich keine Ehe, die im Himmel gestiftet wurde, aber auch keine, die geeignet scheint, mehr als das alltägliche Maß an Unglück hervorzubringen.
Eine angenehme und für denjenigen, der am frühen 19. Jahrhundert ein literarisches oder historisches Interesse hat, gewinnbringende Lektüre. Für Goethe-Kenner und solche, die es werden wollen, ohnehin ein Muss. Der einzige Wermutstropfen ist, dass hier einmal mehr Überlegungen der Verkaufbarkeit über die Ansprüche an Qualität gesiegt haben: Ein solches Buch, von dem zu erwarten ist, dass es für lange Zeit die einzige Ausgabe bleibt, hat einen Leineneinband und Fadenheftung verdient, auch wenn das den Verkaufspreis steigern sollte.
August von Goethe: »Wir waren sehr heiter«. Reisetagebuch 1819. Hg. v. Gabriele Radecke. Berlin: Aufbau, 2007. Pappband, Lese- bändchen, 334 Seiten. 24,95 €.

 Das für die Einschätzung der Person August von Goethes sicherlich wichtigere zweite Tagebuch der Reise nach Italien erschien bereits im letzten großen Goethejahr 1999. Es ist umfangreicher und zugleich konzentrierter, da August von dieser Reise seine Tagebuchblätter direkt nach Weimar schickt und nicht zusätzlich darauf fußende Briefe verfasst. Auch hier hat August von Goethe eine Vorstufe in Form von Notizen auf einzelne Blättern geschrieben, was aber nichts daran ändert, dass in diesem Fall die Tagebuchtexte weitgehend für sich allein stehen.
Das für die Einschätzung der Person August von Goethes sicherlich wichtigere zweite Tagebuch der Reise nach Italien erschien bereits im letzten großen Goethejahr 1999. Es ist umfangreicher und zugleich konzentrierter, da August von dieser Reise seine Tagebuchblätter direkt nach Weimar schickt und nicht zusätzlich darauf fußende Briefe verfasst. Auch hier hat August von Goethe eine Vorstufe in Form von Notizen auf einzelne Blättern geschrieben, was aber nichts daran ändert, dass in diesem Fall die Tagebuchtexte weitgehend für sich allein stehen.
Diese Reise begann am 22. April 1830 und endete bekanntlich mit dem Tod August von Goethes an einem Schlaganfall in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober desselben Jahres in Rom. Diesmal reist August unter deutlich anderen Vorzeichen: Er befindet sich sowohl privat als auch gesundheitlich in einer schweren Krise. Seine Ehe ist offenbar zerrüttet, seine Gesundheit seit längerer Zeit angegriffen. Der Aufbruch aus Weimar kommt einer Flucht gleich: Eigentlich wollten Johann Peter Eckermann und August von Goethe erst am 1. Mai aufbrechen, aber August hällt die Anspannung in Weimar nicht länger aus und drängt Eckermann kurzentschlossen zum verfrühten Aufbruch: »Leben Sie alle wohl ich kann nicht mehr.« (AvG an die Familie Gille am 21. April 1830.) Es ist schwer einzuschätzen, inwieweit August von Goethe seinen gesundheitlichen Zustand hypochondrisch übertreibt, aber er schreibt am 13. Mai aus Mailand in seinem ersten Brief an seine Gattin:
Ich bin nun 150 Meilen weit von Dir entfernt und will Dir doch auch ein vertrauliches Wort zukommen lassen, welches Dir meinen Zustand klar machen soll. Ich ging wirklich so krank aus Weimar daß ich nicht glaubte Frankfurth lebendig zu erreichen, durch die Anstrengung in den letzten 8 Tagen hatten sich alle eine Uebel so gesteigert, daß ich in einem verzweiflungsvollen Zustand den Postwagen bestieg, wie es aber Gott immer mit dem Menschen gut meint so schickte er mir auch hier einen Trost: es war ein gewisser Docter Wapritz Regiments-Arzt beim 1t Garde Regiment in Berlin, welcher nach Paris reißte, ein sehr gebildeter und zugl. lustiger Mann. Ich dachte wenn dir also etwas zustößt so hast du doch ärztliche Hülfe und das gab mir neuen Muth. Bis Frankfurth kam ich also obgleich sehr angegriffen und ohne kaum etwas genossen zu haben denn sogar das Kauen wurde mir beinahe unmöglich schlucken konnte ich auch kaum. Meine Füße waren mir an den Fußsohlen so wund geworden daß ich kaum von der Post in den Gasthoff forthinken konnte und so mußte ich denn in Frankfurth 4 Tage liegen bleiben.
Zumindest subjektiv empfand sich August also zu diesem Zeitpunkt als todkrank. Italien aber lässt ihn aufleben: »alle Systeme kommen ins Gleichgewicht und ich habe die bischen Hoffnung ohne Arzney ganz hergestellt zu werden«. Dies sollte sich letztlich als Trug erweisen.
Auch in Italien ist August im Auftrag des Vaters unterwegs. Das Tagebuch ist direkt an ihn gerichtet und auf die Reiseroute hat Johann Wolfgang von Goethe starken Einfluss genommen. Aber auch so ist sich August in jedem Moment klar, dass er in Stellvertretung reist: Er stellt seine Zeit und seine Wahrnehmung in den Dienst des Vaters und statt in Italien das zu tun, was für ihn am Dringlichsten wäre – sich zu erholen und Abstand zu seiner privaten Misere zu finden –, arbeitet er sich am Auftrag seines Vaters ab.
Und so wie er bis an den Fuß des Vesuv den väterlichen Signalen folgt, zielt auch eine seiner Hauptbeschäftigungen, der Erwerb von Münzen, Medaillen und anderen Kunstgegenständen. auf den kontinuierlichen Ausbau des Bestands der väterlichen Sammlungen. Noch in der Ferne ist August Kustos und Agent des Sammlers und der Seinigen. [Aus dem Nachwort der Hg., S. 286.]
Nicht zuletzt ist es auch sein Alkoholismus, der ihm keine Chance gelassen hat: August lehrte täglich mehrere Flaschen Wein, ein Getränk, an das er bereits von früh an gewöhnt war. August Kestner – der Sohn Charlotte Buffs –, der August von Goethe in seinen letzten Tagen ein Freund war und auch die traurige Pflicht auf sich nahm, den Vater in Weimar zu verständigen und für die Beisetzung auf dem Fremdenfriedhof bei der Pyramide des Cestius Sorge zu tragen, berichtet von Augusts auffallender Trunksucht, ohne dass der davon wirklich trunken geworden wäre. Die Autopsie August von Goethes ergab jedenfalls eine krankhaft vergrößerte Leber und krankhafte Veränderungen des Gehirns, so dass das Urteil der Ärzte lautete, August hätte ohnehin nur noch kurze Zeit zu leben gehabt.
Gerade angesichts der italienische Reise darf man vielleicht die Frage stellen, wie man einem solchen Menschen gerecht werden könnte, außer vielleicht dadurch, dass man zwar seine Existenz zur Kenntnis nähme, ihn aber ansonsten in Ruhe ließe, wie das ja auch bei den Kindern anderer Berühmtheiten hier und da gelingt. Es ist leicht zu urteilen, August von Goethe habe ein verfehltes Leben gehabt; viel schwieriger aber ist es anzugeben, wohin dieses Leben denn hätte zielen sollen, um nicht zu verfehlen, und ob eine solch ganz andere Richtung unter den gegebenen Bedingungen denn überhaupt einzuschlagen gewesen wäre. August von Goethe jedenfalls ist es nicht gelungen, an dem Platz, auf den er gestellt wurde, zu sich selbst zu finden – mag sein, es hat letztlich nur die Zeit dazu gefehlt, mag auch sein, die übermächtige Vaterfigur (die gerade in diesem Fall nicht mit der Privatperson Goethe verwechselt werden sollte) hat dazu keine Chance gelassen. August von Goethe bleibt jedenfalls auch heute noch ein offen am Tage liegendes Rätsel, dem alles Geheimnisvolle zu fehlen scheint.
Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nötigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewußtsein wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?
Auch dieses Buch ist nach den Handschriften gedruckt. Auf den ersten Blick scheinen die glättenden Eingriffe in den Text geringer zu sein, was aber auch daran liegen kann, dass sich Augusts legasthenische Neigungen mit den Jahren und der Alkoholkrankheit verschlimmert haben. Der Anmerkungsteil ist hier sparsamer gehalten, genügt aber wohl den Ansprüchen der meisten Leser.
August von Goethe: Auf einer Reise nach Süden. Tagebuch 1830. Hg. v. Andreas Beyer und Gabriele Radecke. München: Hanser, 1999. Leinen, Fadenheftung, 335 Seiten. 23,50 €.