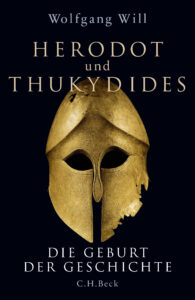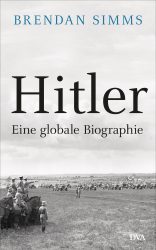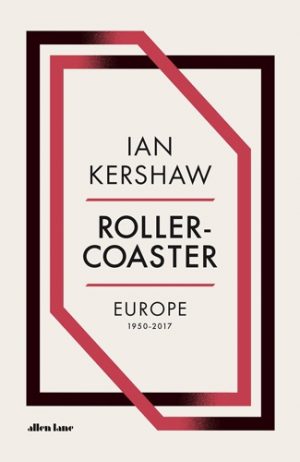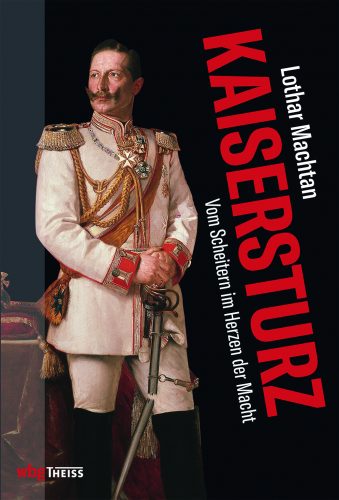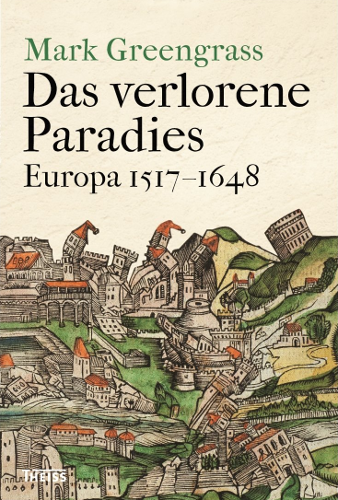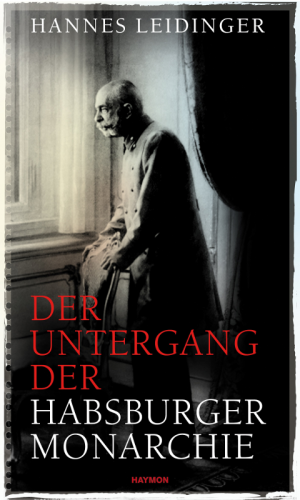Hinzu tritt ein weiteres Moment: Mit der militärischen Wende des Jahres 1942/43 war kaum noch daran zu zweifeln, wie der Krieg ausgehen würde; indes war damals keineswegs vorauszusehen, wann er enden sollte. In jenem zeitlichen Hiatus zwischen dem »Wie« und dem »Wann« entschied sich das Schicksal der noch am Leben verbliebenen Juden Europas. Krieg und Vernichtung folgten einem jeweils anderen Modus.
Diese Geschichte des Zweiten Weltkriegs legt den Fokus auf das jüdische Palästina, sowohl was die Interessen der jüdischen Siedler, die konsequent die Eigenstaatlichkeit anstrebten, als auch was seine Rolle innerhalb des strategischen Konzepts der Briten angeht. Großbritannien betrachtete den Nahen Osten und damit auch Palästina als Teil einer westlichen Verteidigungszone für den indischen Subkontinent. Das Interesse der Briten bestand daher in der Hauptsache an einer möglichst stabilen Situation in dieser Region, da sie mit ihren Streitkräften ein unruhiges Empire und zugleich die britische Insel selbst verteidigen müssen.
Die jüdischen Siedler in Palästina orientieren sich in dieser Zeit zugleich weg von der bisherigen britischen Garantiemacht, die sowohl die Zuwanderung neuer jüdischer Siedler beschränkt als auch den Plan einer Eigenstaatlichkeit der Juden in Palästina aufgegeben hat. Stattdessen wenden sich die Hoffnungen der Siedler den Vereinigten Staaten zu, von denen sie eine entsprechende Unterstützung ihrer politischen Ziele erwarten. In Palästina selbst existiert seit April 1936 eine Revolte der Araber gegen die jüdischen Siedler, die sich konsequent zu bewaffnen suchen.
Die Lage der Juden in Palästina spitzt sich dann bis zum Jahr 1942 zu, als Rommel entscheidende Erfolge in Nordafrika erzielt und zu befürchten ist, dass er über Ägypten hinaus nach Norden vorstoßen wird. Zugleich droht von Norden her eine Gegenbewegung deutscher Truppen, die aus Russland kommend nach Süden vorstoßen könnten, um die Ressourcen des Nahen und Mittleren Ostens zu erobern. Beide Bedrohungen lösen sich erst mit den deutschen Niederlagen von El-Alamein und Stalingrad auf, so dass sich die jüdischen Siedler ab dem Frühjahr 1943 wieder dem lokalen Kampf um Palästina zuwenden können. Diner verschweigt auch nicht die zumeist ungläubigen Reaktionen der Juden Palästinas auf die ersten Nachrichten vom Holocaust, die sie genau in dem Moment erreichen, als die konkrete Bedrohung Palästinas vorübergegangen ist.
Diner liefert keine chronologische Darstellung der Ereignisse, sondern beschreibt in immer neuen Ansätzen die Lage Palästinas, des britischen Empires und der europäischen Juden, die nicht nur von der deutschen Vernichtungsmaschine bedroht sind, sondern auch zum Spielball unterschiedlichster Interessen werden, wenn ihnen die Flucht aus dem deutschen Einflussbereich gelingt. Diese Verschiebung der Perspektive vom gewohnten Blick auf die europäischen und pazifischen Schlachtfelder ergibt neue, ungewöhnliche Einsichten in das Gesamtgeschehen des Krieges.
Insgesamt ein sehr originelles und interessantes Buch, das die komplexen Strukturen, aus denen heraus der Staat Israel erwachsen wird, erstaunlich klar strukturiert und verständlich durchleuchtet. In jeder Hinsicht zu empfehlen.
Dan Diner: Ein anderer Krieg. Das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935 – 1942. München: DVA, 2021. Pappband, 347 Seiten. 34,– €.