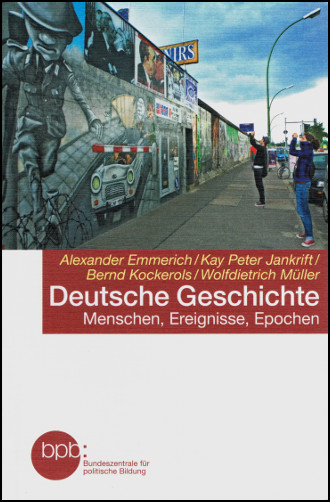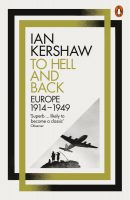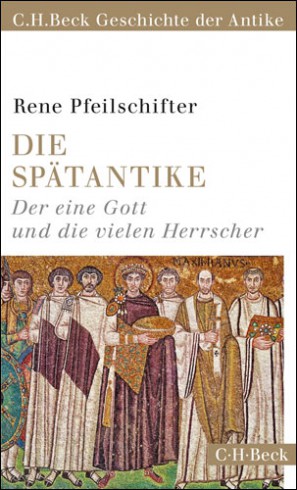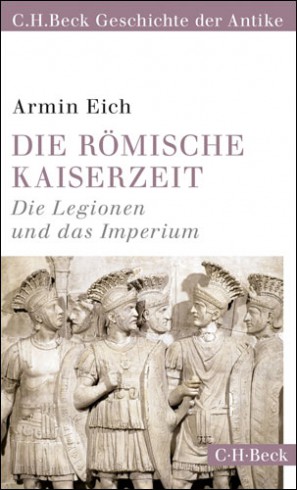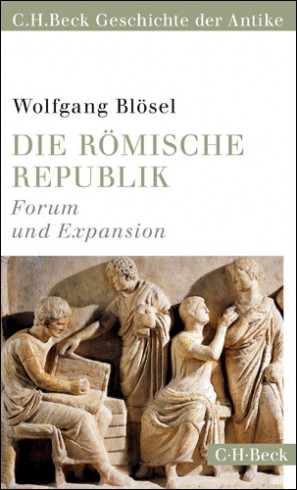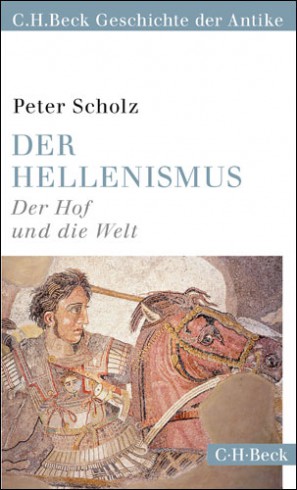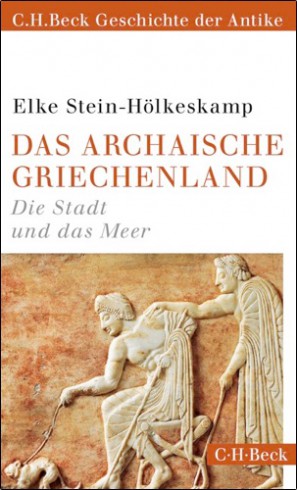Mirabeaus Unglück war nicht seine «unmoralische» Vergangenheit, die er mit vielen Größen der Revolution gemeinsam hatte, als vielmehr seine Zukunft, die ihm seine zahlreichen Talente verhießen. Ebendieses Versprechen, das ihn von den meisten Abgeordneten unterschied, wurde ihm zum Verhängnis.
 Mit „Mirabeau“ liefert Johannes Willms nach „Tayllerand“ eine weitere französische Biographie der Revolutionszeit. Mirabeau stirbt allerdings schon am 2. April 1792, so dass er die Phase des revolutionären Terrors nicht mehr miterleben musste. Mirabeau stammte aus provenzalischem Adel, hatte aber den Großteil seines Lebens mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sein Vater, der selbst ständig in Geldnot war, weigerte sich, ausreichend für den Unterhalt seines verheirateten Sohns zu sorgen, ließ ihn im Gegenteil mehrfach wegen Schuldenmachens festsetzen und sah sich zum Ausgleich in späteren Jahren der öffentlichen literarischen Kritik seines Sohnes ausgesetzt. Mirabeaus Ehe scheiterte exemplarisch, eine einzige wirklich empfundene Liebesaffäre brachte ihm ein Todesurteil ein, dessen Vollstreckung er erfolgreich ausweichen konnte, und er sah sich genötigt, sich längere Zeit als politischer Publizist über Wasser zu halten. Kurz vor Ausbruch der Revolution geht er im Auftrag des französischen Hofes als Spion nach Preussen, aber der anschließend angestrebte Wechsel in den offiziellen diplomatischen Dienst scheitert ebenso wie spätere Versuche, in den Staatsdienst übernommen zu werden.
Mit „Mirabeau“ liefert Johannes Willms nach „Tayllerand“ eine weitere französische Biographie der Revolutionszeit. Mirabeau stirbt allerdings schon am 2. April 1792, so dass er die Phase des revolutionären Terrors nicht mehr miterleben musste. Mirabeau stammte aus provenzalischem Adel, hatte aber den Großteil seines Lebens mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sein Vater, der selbst ständig in Geldnot war, weigerte sich, ausreichend für den Unterhalt seines verheirateten Sohns zu sorgen, ließ ihn im Gegenteil mehrfach wegen Schuldenmachens festsetzen und sah sich zum Ausgleich in späteren Jahren der öffentlichen literarischen Kritik seines Sohnes ausgesetzt. Mirabeaus Ehe scheiterte exemplarisch, eine einzige wirklich empfundene Liebesaffäre brachte ihm ein Todesurteil ein, dessen Vollstreckung er erfolgreich ausweichen konnte, und er sah sich genötigt, sich längere Zeit als politischer Publizist über Wasser zu halten. Kurz vor Ausbruch der Revolution geht er im Auftrag des französischen Hofes als Spion nach Preussen, aber der anschließend angestrebte Wechsel in den offiziellen diplomatischen Dienst scheitert ebenso wie spätere Versuche, in den Staatsdienst übernommen zu werden.
Im Jahr 1789 erkennt Mirabeau in der Einberufung der Generalstände seine Chance, politischen Einfluss zu gewinnen. Er lässt sich als einer von wenigen Adeligen als Abgeordneter des Dritten Standes in die Versammlung wählen und nimmt mit entscheidenden Einfluss auf die Umwandlung der Generalstände in die Nationalversammlung. Als Abgeordneter vertritt Mirabeau eine Linie, für die er auch schon zuvor in seinen Schriften geworben hatte: Er hatte bis zu seinem Tod die Vorstellung, Frankreich in eine konstitutionelle Monarchie zu verwandeln, in der der König als Kopf der Exekutive agiert, die legislative Gewalt aber dem Volk in Gestalt der Nationalversammlung übertragen hat und auf sie höchstens in Form eines Vetos Einfluss nimmt. Er begreift aber erst sehr spät, dass er sich mit dieser Position je länger je weiter von den realen politischen Möglichkeiten entfernt: Die Revolutionäre lehen immer eindeutiger die Idee vom König als vollwertigem Akteur im politischen Prozess ab, während der Hof seine weitgehende politische Tatenlosigkeit wohl mit der illusionären Hoffnung verbindet, eine der revolutionären Krisen zur Rückkehr zu den alten Machtverhältnissen nutzen zu können. Jedenfalls dämmert es Mirabeau erst sehr spät, dass der König keinerlei Interesse daran hat, mit ihm zusammen Frankreich zu retten und dabei seine gesetzgeberische Gewalt endgültig aufzugeben.
Abgesehen von seiner zunehmenden Unfähigkeit, sich den konkreten politischen Umständen anzupassen, scheitert Mirabeau auch mit seinem anderen Plan, als Minister – möglichst ohne Portefeuille – in die Regierung zu wechseln. Sein erster Versuch wird von der Nationalversammlung dadurch abgestraft, dass man Abgeordneten grundsätzlich die Annahme eines Regierungsamtes verbietet; aber auch von der anderen Seite besteht nur wenig Interesse daran, den Revolutionär Mirabeau in das königliche Kabinett zu übernehmen. Erst in seinen letzten Jahren gelingt es Mirabeau, den Hof wenigstens zeitweise von seiner Vertrauenswürdigkeit und politischen Aufrichtigkeit zu überzeugen und sich als Berater des Hofes, sprich: geheimer Zuträger, zu verdingen. Mit diesem heimlichen Wechsel der Fronten gelingt es ihm, auf einen Schlag seine Schulden loszuwerden und zum ersten Mal ein beträchtliches Einkommen zu beziehen. Sofort schlägt sich seine Eitelkeit in einem Lebensstil nieder, der ihn dem Verdacht aussetzt, im Sold des Königs zu stehen. Um diesem Verdacht entgegenzuwirken, sieht er sich gezwungen, sich als radikaler Revolutionär zu gerieren, was ihm wiederum das Mißtrauen des Hofes einträgt. An keiner Stelle scheint ihm der Gedanke gekommen zu sein, sich politisch klug oder auch nur geschickt zu verhalten oder wie ein solches Verhalten hätte aussehen können.
Bei allem rhetorischen Talent und machtpolitischem Instinkt beweist Mirabeau an keiner Stelle seiner Karriere eine wirkliche politische Begabung: Weder ist er zu einer realistischen Einschätzung der sehr dynamischen politischen Situation in Frankreich in der Lage, noch kann er bei auch nur einer einzigen Entscheidung von seinen Eitelkeiten, seinen egoistischen Interessen oder seiner Geld- und Machtgier absehen. All dies scheint von seinen Zeitgenossen auch recht gut begriffen worden zu sein, so dass sich Mirabeau in allen Phasen seiner politischen Laufbahn erheblichem Widerstand gegenüber gesehen hat; niemals aber scheint ihm die Ursache dieses Widerstands aufgegangen zu sein. Es ist nicht ohne Reiz, darüber zu spekulieren, wann und durch wen Mirabeau der Guillotine zugeführt worden wäre, wäre er nicht bereits 1792 verstorben.
Abgesehen von ihrem eher unerfreulichen Gegenstand ist die Biographie durchaus zu empfehlen. Wie immer gelingt Willms eine klar strukturierte und gut lesbare Darstellung, die sich weitgehend einer moralischen Wertung ihres Objektes enthält. Die Gewichtung des biographischen Materials ist der historischen Rolle Mirabeaus angemessen: Etwa die Hälfte des Buches ist den letzten knapp 3 Jahren in Mirabeaus Leben gewidmet. Als einzigen Mangel könnte man empfinden, dass man sich von den gesellschaftlichen Lebensumständen Mirabeaus in seinen letzten Jahren ein nur fragmentarisches Bild machen kann und dass seine Erkrankung und sein Tod überraschend kurz abgehandelt werden.
Johannes Willms: Mirabeau oder Die Morgenröte der Revolution. München: C. H. Beck, 2017. Pappband, 397 Seiten. 26,95 €.