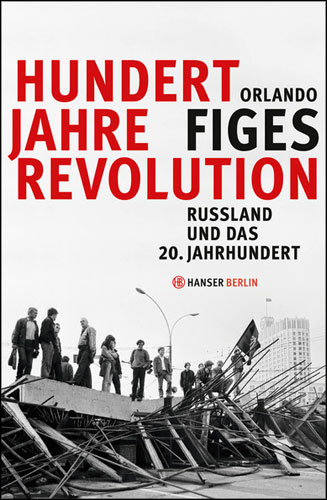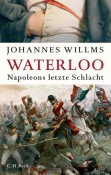Es ist bei populären wissenschaftlichen Sachbüchern eher selten der Fall, dass es ihr Autor wagt, das Wir wissen es nicht als die derzeit gültige Antwort auf ein Problem hinzustellen; umso angenehmer, wenn es einem dann doch hin und wieder begegnet. Eric H. Cline, Direktor des Archäologischen Instituts an der George Washington University, gibt in diesem Buch einen umfassenden Überblick über den derzeitigen Kenntnisstand zu Entstehung und Untergang der bronzezeitlichen Kulturen im östlichen Mittelmeerraum.
Es ist bei populären wissenschaftlichen Sachbüchern eher selten der Fall, dass es ihr Autor wagt, das Wir wissen es nicht als die derzeit gültige Antwort auf ein Problem hinzustellen; umso angenehmer, wenn es einem dann doch hin und wieder begegnet. Eric H. Cline, Direktor des Archäologischen Instituts an der George Washington University, gibt in diesem Buch einen umfassenden Überblick über den derzeitigen Kenntnisstand zu Entstehung und Untergang der bronzezeitlichen Kulturen im östlichen Mittelmeerraum.
Mehr als 300 Jahre lang – von der Herrschaft der Hatschepsut ab ca. 1500 v. Chr. bis zum Zusammenbruch nach 1200 v. Chr. – war das Mittelmeer der späten Bronzezeit Schauplatz einer komplexen internationalisierten Welt, in der Minoer, Mykener, Hethiter, Assyrer, Babylonier, Mitani, Kanaaniter, Zyprer und Ägypter miteinander interagierten. Es war eine kosmopolitische und globalisierte Welt, wie es sie in der Geschichte der Menschheit bis heute nur selten gegeben hat.
Cline macht einsichtig, wie sich über mehrere Jahrhunderte hinweg in diesem Gebiet zahlreiche Kulturen entwickelten und komplexe politische und ökonomische Beziehungen miteinander unterhielten. Er schildert dabei ausreichend detailliert und zugleich für den Laien nachvollziehbar, auf welche archäologischen Funde und schriftlichen Quellen sich unser momentanes Bild dieser Epoche stützt. Dabei findet stets eine ebenso zurückhaltende wie sichere Bewertung der vorgeschlagenen Deutungen der Artefakte statt: Cline nennt eine Spekulation eine Spekulation, eine Vermutung eine Vermutung und eine sichere Erkenntnis eine sichere Erkenntnis. Beim Leser entsteht so zugleich sowohl ein reiches Bild der bronzezeitlichen Welt im Großen als auch ein Bewusstsein davon, auf einer wie schmalen Grundlage von Funden bzw. Quellen dieses Bild basiert.
Das eigentliche Problem oder Rätsel der bronzezeitlichen Welt im Mittelmeerraum stellt aber ihr weitgehender Zusammenbruch im 12. Jahrhundert v.u.Z. dar, dem dann die sogenannten Dunklen Jahrhunderte folgen, bis – insbesondere in Griechenland – eine neue Kultur wieder archäologisch und historisch greifbar wird. Seit dem 19. Jahrhundert wird eine kontinuierliche, wissenschaftliche Diskussion über diesen Zusammenbruch der bronzezeitlichen Zivilisation(en) geführt, wobei dafür abwechselnd barbarische Eroberer (eine von den Griechen der klassischen Zeit selbst vertretene These; leider taugen die von ihnen angezeigten Dorer aufgrund der heute bekannten Faktenlage nicht als Täter), Naturkatastrophen (Erdbeben, Vulkanausbrüche), Klimawandel (Dürre), Hungersnöte, Seuchen (die einzige inzwischen wohl nicht mehr vertretene Erklärung, wenn man ihr Fehlen in Clines Buch als Indiz dafür nehmen darf) oder allgemein humane oder organisatorische Degenerationserscheinungen verantwortlich gemacht wurden.
Leider taugen alle diese Gründe nicht, um jeweils für sich allein den Untergang der Zivilisationen des östlichen Mittelmeerraums zu begründen. Die einzige tatsächlich fassbare Gruppe von Eroberern, die sogenannten Seevölker, deren genaue Herkunft und Zusammensetzung bis heute unklar sind, hat sicherlich einige Unruhe und Zerstörung verursacht, ist aber zu unbedeutend, um den ganzen Kulturraum zu destabilisieren. (Im titelgebenden Jahr 1177 v.u.Z. gab es eine Schlacht zwischen besagten Seevölkern und den Truppen des ägyptischen Pharaos Ramses III., in der die Ägypter siegreich blieben; ansonsten spielt das Jahr keine bedeutende Rolle im Buch und markiert höchstens symbolisch den Zeitpunkt des Untergangs der bronzezeitlichen Welt.) Auch hat es nachweislich in dieser Zeit Erdbeben, Trockenheit und Hungersnöte gegeben, doch auch mit ihren Folgen schien man in der Bronzezeit bereits einigermaßen umgehen zu können. Es wurde daher in den letzten Jahren vorgeschlagen, dass die bronzezeitliche Kultur einfach an sich selbst untergegangen ist: Sie soll so komplex geworden sein, dass es einer Reihe von Ereignissen, die jedes für sich genommen nicht ausgereicht hätten, den Untergang herbeizuführen, in der Kombination gelungen ist, das Gesamtsystem Bronzezeit zum Kollaps zu bringen. Es ist Cline hoch anzurechnen, dass er diese Theorie wie folgt einordnet:
Trotz allem kann es auch sein, dass wir mit der Komplexitätstheorie zur Analyse der Ursachen des Kollapses der Spätbronzezeit lediglich einen wissenschaftlichen (möglicherweise sogar pseudowissenschaftlichen) Begriff auf eine Situation anwenden, über die wir schlichtweg nicht genügend wissen, um überhaupt irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Wer sich einen Überblick über die Hochzeit der Zivilisation des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens in der späten Bronzezeit verschaffen will, dem sei dieses inhaltlich hervorragende, sehr gut lesbare Buch unbedingt empfohlen. Selbst demjenigen, der sich in der Welt der griechischen und ägyptischen Bronzezeit schon einigermaßen auskennt, bietet der präzise und ausgewogene Überblick über die Faktenlage, den Cline liefert, ein so konzises Bild dieser Epoche, wie es sich derzeit geben lässt. Eine der besten Einführungsdarstellungen überhaupt, die ich seit langem gelesen habe.
Eric H. Cline: 1177 v. Chr. Der erste Untergang der Zivilisation. Aus dem Englischen von Cornelius Hartz. Darmstadt: Theiss, 2015. Pappband, 336 Seiten. 29,95 €.