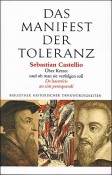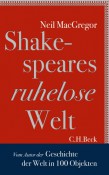Das Einreise-Verbot der USA für Ilija Trojanow, der wohl zu einem Germanisten-Kongress unterwegs war, ist ein schöner Anlass, sein gerade erschienenes Buch zu lesen. Trojanow ist einer jener jüngst so vehement angeforderten kritischen Schriftsteller, die sich mit dem jeweils rezenten gesellschaftlichen und politischen Elend auseinandersetzen. Bei Trojanow ist der Kern des derzeitigen Übels – wenig originell – der Kapitalismus, wobei der Begriff bei ihm wie fast überall sonst, wo er gebraucht wird, gleich zweifach mangelhaft bleibt: Weder wird an irgendeiner Stelle des Büchleins auch nur ansatzweise versucht zu definieren, was denn Kapitalismus sein soll, noch wird uns an irgendeiner Stelle eine moderne, praktikable Form des Wirtschaftens vorgestellt, die – und sei es auch nur in der Theorie – nichtkapitalistisch funktioniert. Offenbar ist solche Genauigkeit unter den Teilnehmern des großen kritischen Stammtischs unnötig: Alle wissen ohnehin Bescheid darüber, was genau Kapitalismus ist und wie er funktioniert.
Das Einreise-Verbot der USA für Ilija Trojanow, der wohl zu einem Germanisten-Kongress unterwegs war, ist ein schöner Anlass, sein gerade erschienenes Buch zu lesen. Trojanow ist einer jener jüngst so vehement angeforderten kritischen Schriftsteller, die sich mit dem jeweils rezenten gesellschaftlichen und politischen Elend auseinandersetzen. Bei Trojanow ist der Kern des derzeitigen Übels – wenig originell – der Kapitalismus, wobei der Begriff bei ihm wie fast überall sonst, wo er gebraucht wird, gleich zweifach mangelhaft bleibt: Weder wird an irgendeiner Stelle des Büchleins auch nur ansatzweise versucht zu definieren, was denn Kapitalismus sein soll, noch wird uns an irgendeiner Stelle eine moderne, praktikable Form des Wirtschaftens vorgestellt, die – und sei es auch nur in der Theorie – nichtkapitalistisch funktioniert. Offenbar ist solche Genauigkeit unter den Teilnehmern des großen kritischen Stammtischs unnötig: Alle wissen ohnehin Bescheid darüber, was genau Kapitalismus ist und wie er funktioniert.
Natürlich sieht sich jeder Gutwillige genötigt, Trojanows Einsichten ins Elend zuzustimmen: Die Folgen des Kapitalismus sind für einen zunehmend größer werdenden Anteil der Menschheit höchst nachteilig: Hartz-IV-Empfängern und jenen, die in der sogenannten Dritten Welt auf den Müllkippen um ihr Überleben kämpfen, geht es schlecht – vielleicht nicht gleich schlecht, aber es könnte hier wie dort besser sein. Dies liegt offensichtlich an der ungerechten Verteilung des vorhandenen Geldes (Trojanow spricht zwar von Reichtum oder Vermögen, meint am Ende aber faktisch nur Geld, nicht Kapital) sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Abgesehen von Feinheiten geht es jenen schlecht, die wenig Geld haben, und jenen gut, die über viel davon verfügen. Unter denen, denen es schlecht geht, geht es vielen noch schlechter als anderen; unter denen, denen es gut geht, geht es einigen wenigen so gut, dass es leider nicht mehr besser gehen kann. Einige von denen, denen es gut geht, meinen nun, dass man eigentliche keine Leute braucht, denen es schlecht geht, und man auf solche Leute auch gut verzichten könnte. Der einfachste Weg, auf diese Leute zu verzichten, ist, sie abzuschaffen. Solche Leute plädieren in einem „erstaunlichen posthumanitären Cocktail aus neomalthusianischen und fundamentalistisch sozialdarwinistischen Positionen“ für eine Reduktion der Weltbevölkerung. Soweit die Analyse.
Als Prognose sagt Trojanow – ganz entlang der Linie der Marxschen (der natürlich an keiner Stelle auch nur erwähnt wird!) Akkumulations- und Verelendungstheorie – eine Zunahme des revolutionären Potenzials voraus. Was das Ziel der angeblich heraufdämmernden Revolution angeht, redet er sich mit einem Zitat von Georgi Konstantinow heraus: „In einem solchen revolutionären Moment ist es unmöglich, die Richtung der Veränderung vorherzusagen.“ Trojanow lässt dem noch eine etwas flach geratene Betrachtung über die modischen apokalyptischen Phantasien Hollywoods folgen, um sich abschließend unter der Überschrift „Auswege“ zu folgender Forderung aufzuschwingen:
Wir müssen uns unverzagt vorstellen, wie eine bessere Gesellschaft und ein tatsächlich gerechtes und nachhaltiges Wirtschaften aussehen können. Wir benötigen utopische Entwürfe, wir brauchen Träume, wir müssen Verwegenes atmen. [Hervorhebungen nicht im Original.]
Dies ist die konzise Zusammenfassung des momentanen Elends der Gesellschaftskritik: Die einzige wenigstens halbwegs ordentliche politische Utopie der Verteilungsgerechtigkeit, zu der sich die Moderne hat verdichten können, ist nicht nur 150 Jahre alt, sie ist auch durch einen nach ihr benannten praktischen Versuch derartig desavouiert worden, dass man den Namen ihres Begründers heute besser nicht einmal erwähnen sollte, um sich nicht sogleich dem Spott der politischen Kleingeister auszusetzen. Eine andere theoretisch fundierte und mit Blick auf eine menschliche Praxis ausgearbeitete Utopie für eine gerechte oder auch nur gerechtere Gesellschaft fehlt.
Ich könnte nun darauf hinweisen, dass all dies nur dann tatsächlich ausreichend durchdrungen werden kann, wenn man sich auf die Kantische Einsicht besinnt, dass beinah alles philosophische Fragen letztlich in die Frage „Was ist der Mensch?“ mündet. Eine Frage, deren Antwort tatsächlich so unausdenklich ist, dass jeder, der eine Antwort auch nur versucht, sich allein deshalb schon dem Verdacht aussetzt, Unrecht zu haben. Und ich könnte darauf hinweisen, dass der andere, fast ebenso radikale Utopist des 19. Jahrhunderts uns heftig auf die Einsicht hingestoßen hat, dass der Mensch ein halbgares Zwischenprodukt darstellt, ein Wesen, das zwar die Idee der Gerechtigkeit erfassen kann, zu ihrer Realisierung wenigstens im Großen aber noch gänzlich unfähig zu sein scheint. Und schließlich kann es kein gutes Zeichen sein, dass wir – vielleicht mit der Ausnahme von John Rawls – in unserer Diskussion des Elends, in dem wir uns vorgefunden haben, immer noch nicht wesentlich über das 19. Jahrhundert hinausgekommen sind.
Angesichts dieser desolaten Lage ist es schon fast wieder tröstlich, dass Trojanows Kritik mit einem Lob der Vita contemplativa – im Sinne des Aristoteles, nicht Benedikts – ausklingt:
Selten halten wir inne, nehmen Auszeit von einem rasanten Alltag aus Pflicht und Unterhaltung, sitzen am Ufer oder schwingen auf der Schaukel, der Kontemplation zugetan oder einfach nur dem Nichtstun.
Ilija Trojanow: Der überflüssige Mensch. St. Pölten u. a.: Residenz, 2013. Kindle-Edition, 324 KB, 96 Seiten (gedruckte Ausgabe). 9,99 €.