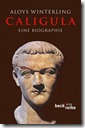Sehr detaillierte Darstellung der Reise Konrad Adenauers nach Moskau im September 1955 einschließlich der Vorgeschichte beginnend mit der sowjetischen Einladung vom 7. Juni des Jahres bis hin zu den ersten Monaten der diplomatischen Beziehungen, die als Folge der Reise etabliert wurden. Kilian konzentriert sich nahezu vollständig auf die politische Ebene der Reise inklusive der Einschätzungen und Reaktionen der drei westlichen Siegermächte. Er macht Adenauers innen- und außenpolitische Taktik und seine Verhandlungsführung in Moskau plausibel durch die unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Zielvorstellungen, die er gleichzeitig zu erfüllen suchte: Klärung der Frage der verbliebenen Kriegsgefangenen sowie der Zivilverschleppten, Demonstration der Bündnistreue dem Westen gegenüber, Demonstration einer eigenständigen deutschen, weltpolitischen Position, Durchsetzung seiner Auffassung, dass die Frage der deutschen Einheit Aufgabe der vier Siegermächte sei und letztlich Vermeidung auch nur des Anscheins der Aufgabe des Alleinvertretungsanspruchs der BRD.
Sehr detaillierte Darstellung der Reise Konrad Adenauers nach Moskau im September 1955 einschließlich der Vorgeschichte beginnend mit der sowjetischen Einladung vom 7. Juni des Jahres bis hin zu den ersten Monaten der diplomatischen Beziehungen, die als Folge der Reise etabliert wurden. Kilian konzentriert sich nahezu vollständig auf die politische Ebene der Reise inklusive der Einschätzungen und Reaktionen der drei westlichen Siegermächte. Er macht Adenauers innen- und außenpolitische Taktik und seine Verhandlungsführung in Moskau plausibel durch die unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Zielvorstellungen, die er gleichzeitig zu erfüllen suchte: Klärung der Frage der verbliebenen Kriegsgefangenen sowie der Zivilverschleppten, Demonstration der Bündnistreue dem Westen gegenüber, Demonstration einer eigenständigen deutschen, weltpolitischen Position, Durchsetzung seiner Auffassung, dass die Frage der deutschen Einheit Aufgabe der vier Siegermächte sei und letztlich Vermeidung auch nur des Anscheins der Aufgabe des Alleinvertretungsanspruchs der BRD.
Es wird in der Konsequenz klar, dass man Adenauers Reise je nach Perspektive durchaus als Erfolg oder Niederlage werten kann: Sicherlich war sie einerseits innenpolitisch ein unerwartet großer Erfolg, der sich markant im Wahlergebnis von 1957 niedergeschlagen hat, andererseits hatte man in Moskau nur ein einziges Verhandlungsziel überhaupt erreicht – die Gefangenenentlassung, von der wir heute wissen, dass die Sowjetführung sie ohnehin auf der Agenda stehen hatte – und musste dafür im Gegenzug der sowjetischen Seite die Aufnahme normaler diplomatischer Beziehungen einräumen. Damit hatten die Gegenseite ihr einziges Verhandlungsziel vollständig erreicht.
Was bei Kilian etwas zu kurz kommt, ist die gesellschaftliche Ebene, sowohl was die Voraussetzungen der Reise angeht, als auch die euphorische Reaktion der Westdeutschen auf das Eintreffen der letzten 10.000 Kriegsgefangenen. Besonders die doch sehr unterschiedliche Behandlung der Kriegsheimkehrer in West- und Ostdeutschland hätte man sich etwas ausführlicher dargestellt gewünscht. Aber man kann nicht alles haben.
Mir persönlich ist die Darstellung an einigen Stellen zu Adenauer-freundlich, insgesamt steht das Buch aber völlig konkurrenzlos da und muss derzeit als beste Informationsquelle zu diesem wichtigen Abschnitt deutscher Geschichte bezeichnet werden.
Werner Kilian: Adenauers Reise nach Moskau. Freiburg i.B.: Herder, 2005. Broschur, 381 Seiten. 15,– €.