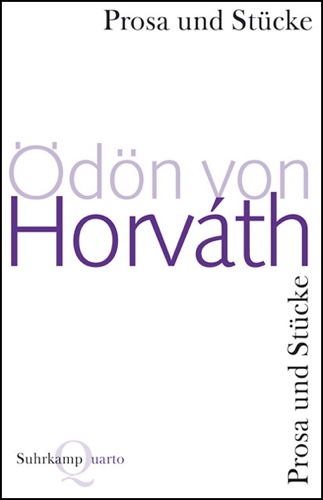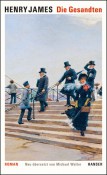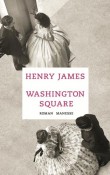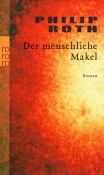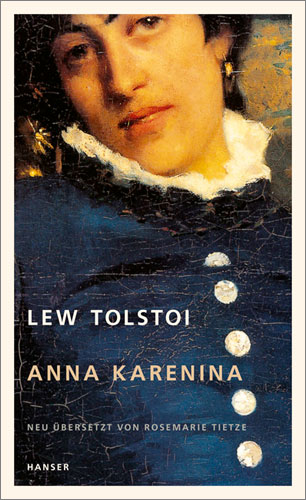Mit sechs vollendeten Bänden und insgesamt knapp 2.900 Seiten stellt Arnold Zweigs Zyklus „Der große Krieg der weißen Männer“ die umfangreichste literarische Auseinandersetzung eines deutschsprachigen Schriftstellers mit dem Ersten Weltkrieg dar. Den Keim des Zyklus bildete der 1927 erschienene (auf 1928 vordatierte) Roman „Der Streit um den Sergeanten Grischa“, den Zweig schon während der Niederschrift zu einer Trilogie des Übergangs auszubauen plante. „Der Streit um den Sergeanten Grischa“ war einer der erfolgreichsten deutschen Antikriegsromane und erreichte bis 1933, als der Autor ins Exil ging und seine Schriften in Deutschland verboten und verbrannt wurden, immerhin eine Auflage von 300.000 Exemplaren.
Mit sechs vollendeten Bänden und insgesamt knapp 2.900 Seiten stellt Arnold Zweigs Zyklus „Der große Krieg der weißen Männer“ die umfangreichste literarische Auseinandersetzung eines deutschsprachigen Schriftstellers mit dem Ersten Weltkrieg dar. Den Keim des Zyklus bildete der 1927 erschienene (auf 1928 vordatierte) Roman „Der Streit um den Sergeanten Grischa“, den Zweig schon während der Niederschrift zu einer Trilogie des Übergangs auszubauen plante. „Der Streit um den Sergeanten Grischa“ war einer der erfolgreichsten deutschen Antikriegsromane und erreichte bis 1933, als der Autor ins Exil ging und seine Schriften in Deutschland verboten und verbrannt wurden, immerhin eine Auflage von 300.000 Exemplaren.
Während der Entstehung des ersten Bandes der geplanten Trilogie wurde Zweig klar, dass er den Stoff werde auf zwei Bände aufteilen müssen. So erschien 1931 „Junge Frau von 1914“ und – bereits aus dem Exil in Haifa heraus im Querido Verlag – 1935 „Erziehung vor Verdun“. Diese drei Bände sollten die bekanntesten und erfolgreichsten des Zyklus bleiben. Wie geplant, schloss Zweig 1937 die nun zur Tetralogie gewachsene Serie mit „Einsetzung eines Königs“ (ebenfalls im Querido Verlag) vorerst ab.
Erst nach der Rückkehr aus dem Exil nach Ostberlin erweiterte Zweig den Zyklus: Er sollte nach seiner Planung letztendlich acht Bände umfassen, doch konnte Zweig nur noch zwei weitere fertigstellen. Im Jahr 1954 erschien im Aufbau-Verlag der Roman „Die Feuerpause“, dessen Handlung chronologisch zwischen „Der Streit um den Sergeanten Grischa“ und „Einsetzung eines Königs“ angesiedelt ist und der noch einmal auf Material zurückgreift, das bereits in „Erziehung vor Verdun“ verarbeitet worden war. Anschließend plante Zweig um die nun fünf Bände einen weiteren Ring zu legen: 1957 wurde „Die Zeit ist reif“ gedruckt, der die Vorgeschichte der beiden Hauptfiguren Werner Bertin und Lenore Wahl lieferte. Unveröffentlichtes Fragment blieb der Band „Das Eis bricht“, der die Handlung über die eigentliche Kriegszeit hinaus in die entstehende Weimarer Republik verlängern sollte; darüber hinaus plante Zweig noch einen Band „In eine bessere Zeit“, der wohl eine Anbindung des Zyklus an die Jetztzeit des Autors liefern sollte.
Nach der inneren Chronologie der Erzählung ergibt sich also folgendes Bild des Zyklus:
- „Die Zeit ist reif“ (1957)
- „Junge Frau von 1914“ (1931)
- „Erziehung vor Verdun“ (1935)
- „Der Streit um den Sergeanten Grischa“ (1927)
- „Die Feuerpause“ (1954)
- „Einsetzung eines Königs“ (1937)
- „Das Eis bricht“ (unveröffentl. Fragment)
- „In eine bessere Zeit“ (nicht verwirklichter Plan)
Ich werde die Romane des Zyklus hier in den kommenden Monaten entlang der Chronologie der Handlung vorstellen. Meiner Lektüre liegen Einzelausgaben des Aufbau-Verlages zwischen 1959 und 1980 zugrunde, die ich während meiner Studienzeit antiquarisch erworben habe. Derzeit sind beim Aufbau Verlag (jetzt nur echt ohne Bindestrich) nur vier der sechs Titel ( die Nummern 2, 3, 4 und 6 der oben stehenden Liste) im Taschenbuch lieferbar. Warum es der Verlag bislang versäumt hat, den Zyklus in diesem Jahr wieder vollständig aufzulegen und entsprechend zu bewerben, ist mir unbekannt. Aber das Jahr ist ja noch lang.

„Die Zeit ist reif“ (1957) ist also der zuletzt entstandene, in der Chronologie der Ereignisse aber früheste Roman des Zyklus. Erzählt wird in der Hauptsache die Geschichte des deutsch-jüdischen Liebespaares Lenore Wahl und Werner Bertin vom August 1913 bis zum beginnenden Frühjahr 1915, die sich als Kommilitonen in München kennengelernt haben. Sie befinden sich im August 1913 auf einer Ferienreise in Tirol und Norditalien, verbringen einige glückliche Tage in Venedig und reisen dann wieder nach Deutschland zurück.
Lenore Wahl stammt aus großbürgerlichen Verhältnissen in Berlin: Ihr Vater Hugo ist Mitinhaber einer zusammen mit ihrem Großvater Markus geführten Bank. Lenore studiert Kunstgeschichte und verheimlicht ihre Liebesbeziehung mit Werner vor ihren Eltern, nicht aber vor ihrem deutlich liberaleren Großvater. Werner Bertin stammt aus einer schlesischen Handwerker-Familie und ist offiziell Jura-Student. Er steht seit längerer Zeit kurz vor dem Abschluss seines Studiums mit der Promotion. Tatsächlich arbeitet er aber schon mehrere Jahre an einer Karriere als Schriftsteller, hat auch bereits einen Roman – „Liebe auf den letzten Blick“ – veröffentlicht, der ihm von allen vernünftigen Leuten in der Erzählung Lob und Anerkennung einbringt. Zur Zeit der Italien-Reise mit Lenore arbeitet er an einem Drama um einen mittelalterlichen jüdischen Bischof [sic!], der in einen Konflikt mit einem deutschen Hauptmann gerät. Außerdem wird er von Lenores Großvater auf eine Preisaufgabe der Freimaurerloge in St. Peterburg aufmerksam gemacht, die „eine Abhandlung über Gott und die Gegenwart“ mit einem erheblichen Geldbetrag prämieren will. Zwar steht Werner diesem Thema vorerst fern, doch der Geldbetrag und die mit dem Gewinn verbundene Publizität, die die Hochzeitspläne des Paares befördern könnten, sind als Anreize stark genug.
Nachdem die beiden Hauptfiguren nach Deutschland zurückgekehrt sind, trennt sie der Autor vorerst: Werner übernimmt, um Geld zu verdienen, stellvertretend einen Posten als Redakteur einer Zeitschrift in Breslau, während Lenore von ihrem Großvater mit Geschäften nach Straßburg geschickt wird, wo sie einen jungen Bankier kennenlernt, mit dem sie Karneval 1914 in München eine kurze Affäre haben wird. Anschließend werden beide für ein Semester wieder in München vereint, wo sie in einem Vorort als Studenten praktisch in wilder Ehe leben. Die Julikrise und der Kriegsausbruch am 1. August 1914 treffen sie so überraschend wie die meisten anderen Deutschen. Werner ist aufgrund seiner schwachen körperlichen Konstitution und seiner starken Sehbehinderung nur eingeschränkt tauglich und muss vorerst nicht damit rechnen, zur Reichswehr eingezogen zu werden. Beide beschließen, ihre Studien in Berlin fortzusetzen, da Lenore angesichts des Krieges in die Nähe ihrer Familie zurück soll.
Nach einer weiteren kurzen Trennung treffen sich die Liebenden also in Berlin wieder. Von nun an werden die Hochzeitspläne zwischen den beiden die Hauptrolle spielen: Werner wird auch von Lenore ihren Eltern vorgestellt, aber hauptsächlich aufgrund seiner offen geäußerten Kritik am hohenzollerschen Kaiserhaus nehmen beide Eltern Wahl, die über den Status der Beziehung zwischen Lenore und Werner immer noch im Unklaren sind, gegen den jungen Mann eine sehr ablehnde Haltung ein. Die Preisschrift über „Gott und die Gegenwart“ stellt Werner zwar fertig, aber der Kriegsausbruch und der Autor verhindern gemeinsam, dass sie St. Petersburg erreichen kann. Werner plant daher, sie als Dissertation einzureichen, da seine ursprüngliche Dissertation auch weiterhin nicht fertiggestellt ist; doch auch dieser Plan zerschlägt sich aufgrund der mangelhaften formalen Ausbildung Werners.
Der Roman schließt mit den Gedanken Werners, ob es nicht seine Pflicht sei, sich freiwillig zum Militärdienst zu melden. Als ironische Spitze inszeniert Zweig schließlich eine Begegnung zwischen dem jungen Paar und zwei preußischen Militärs, die in einer Nebenhandlung des Romans eine Rolle spielen und auch im weiteren Romanzyklus Schlüsselstellen einnehmen werden. Bei dieser zufälligen Begegnungen legen die beiden Militärs den jungen Leuten die Frage vor, ob man der italienischen Forderung nach dem Anschluss Südtirols an Italien nachgeben oder eine dritte, südliche Front riskieren solle. Mit dem begeisterten Bekenntnis der beiden Studenten dazu, dass Südtirol eine alte deutsche Kulturlandschaft darstelle und nicht aufgegeben werden dürfen, entlässt sie der Autor in die sich anbahnende Katastrophe.
Sowohl Lenore Wahl als auch Werner Bertin sind als Typen angelegt: Während Lenore als positives Exempel einer nach Unabhängigkeit und Selbstständigkeit strebenden jungen Frau gestaltet ist, die sich besonders durch körperliche und sexuelle Freizügigkeit (alles gemessen an den bürgerlichen Standards des Kaiserreiches) auszeichnet und mehr und mehr zu einem realistischen Bild ihres Freundes Werner gelangt, ist Werner Bertin der typische unpolitische, bürgerliche Intellektuelle, der zwar große weltpolitische Reden führt, von der Sache und den realen Zusammenhängen letztlich aber wenig versteht. Er wird zwar immer wieder als intellektuell und schriftstellerisch begabt geschildert, zugleich wird er aber von mehreren Figuren des Romans explizit als „Dummkopf“ eingeschätzt.
Die beide in den Protagonisten angelegten Dichotomien überzeugen nur bedingt: Bei Lenore bleiben ihr emanzipatorisches Streben und ihre romantische Bindung an Werner bis zum Ende unvermittelt nebeneinander stehen, wobei besonders ihre romantischen Gefühle in einer Sprache geschildert werden, die die Grenze zum Kitsch gefährlich streift:
Und so fortan, dachte sie, in einer Formel des alten Goethe ihrer beider ganzes junges Leben umfassend. Und hingewendet zum Schicksal, dessen Gegenwart sie auf kindliche Weise hinter die unendliche Bläue des Himmels setzte: Sollte einer von ihnen die Bürden des Bündnisses tragen, so sie, deren Rücken bisher von der Schwere des Irdischen verschont geblieben. Nimm mich an, bat sie, stumm vor Liebe; ein weitgeöffnetes Auge von jenseits der Luft blickte, schien ihr, Gewährung; es überrann sie heiß, sie straffte die Schultern, ballte die kleinen Fäuste, griff gleichsam zu. Sie wußte nicht, was alles sie damit auf sich nahm.
(Zu Zweigs Verteidigung muss betont werden, dass nur ein kleiner Teil des Romans in stilistischem Schulst wie diesem verfasst ist.) Auch Werner Bertins Gestaltung kommt über die Spannung zwischen einer von den harten Realitäten unbeleckten Intellektualität und den angeblich tatsächlichen Anforderungen der Zeit nicht hinaus. Hinzu kommt, dass sich der heutige Leser des Romans kaum des Eindrucks erwehren kann, dass sich das alles auch knapper und prägnanter hätte darstellen lassen. Zwar ist das Bestreben Zweigs verständlich, seinen Zyklus in die Vor- bzw. Nachkriegszeit hinein zu ergänzen, es bleibt aber kritisch zu fragen, ob die immerhin 600 Seiten dieses Spätwerks wirklich genug Zugewinn bringen, um seine Lektüre zu empfehlen.
Arnold Zweig: Die Zeit ist reif. Berlin: Aufbau-Verlag, 31959. Leinen, Fadenheftung, 600 Seiten. Derzeit nicht lieferbar.