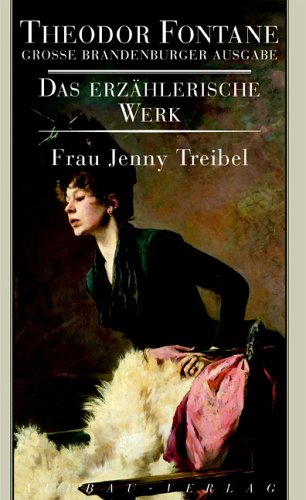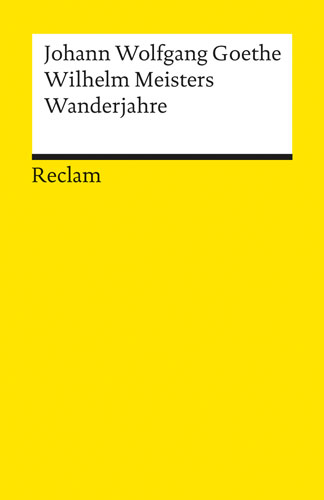Wenn ich gewußt hätte wie gut die Toten reden haben. Die Toten sollen das Maul halten.
 Zum ersten Mal wahrgenommen habe ich Uwe Johnsons „Jahrestage“ in meinem ersten Semester an der Universität Tübingen. Da kam der Autor zu seiner allerletzten öffentlichen Lesung, denn zur Buchmesse war endlich der vierte und abschließende Band des Romans erschienen, und Johnson las in einem der großen Hörsäle im Tübinger Brechtbau vor einem übervollen Haus aus den Abschnitten, in denen Gesine Cresspahl von ihrem Deutschunterricht und Theodor Fontanes „Schach von Wuthenow“ erzählt. Anschließend wollte oder konnte kein einziger der Zuhörer auch nur eine einzige Frage stellen – mir ist bis heute nicht so ganz genau klar, warum nicht –, so dass sich Johnson selbst was fragte und es beantwortete. Ich vermute fast, es ist ihm im Leben oft so ergangen.
Zum ersten Mal wahrgenommen habe ich Uwe Johnsons „Jahrestage“ in meinem ersten Semester an der Universität Tübingen. Da kam der Autor zu seiner allerletzten öffentlichen Lesung, denn zur Buchmesse war endlich der vierte und abschließende Band des Romans erschienen, und Johnson las in einem der großen Hörsäle im Tübinger Brechtbau vor einem übervollen Haus aus den Abschnitten, in denen Gesine Cresspahl von ihrem Deutschunterricht und Theodor Fontanes „Schach von Wuthenow“ erzählt. Anschließend wollte oder konnte kein einziger der Zuhörer auch nur eine einzige Frage stellen – mir ist bis heute nicht so ganz genau klar, warum nicht –, so dass sich Johnson selbst was fragte und es beantwortete. Ich vermute fast, es ist ihm im Leben oft so ergangen.
Danach habe ich mir die vier Bände, die es damals noch nur im Leineneinband gab, peu à peu zugelegt und mich hineingelesen in die Welt und die Tage der Gesine Cresspahl und ihrer Tochter Marie, die – darauf bestand ihr Autor bei allen Gelegenheiten – keine Figuren sind, sondern Personen waren und mit denen man demgemäß Umgang zu pflegen hatte. Jetzt, 30 Jahre später, sind die vier Bände nicht nur erneut im Taschenbuch aufgelegt worden, sondern auch als eBook; allerdings auch hier immer noch in vier Teilen anstatt als der eine große Roman, als den Johnson den Text gelesen haben wollte. Wahrscheinlich will man bei Suhrkamp Rücksicht auf die Leser nehmen, sich nicht um den Gewinnst bringen von vier Verkäufen statt einem, und wer bei Suhrkamp mag sich überhaupt noch auskennen mit dem, was ein alter Sturkopf ehemals so alles gewollt haben mag. Ich jedenfalls habe die Dateien zum Geburtstag geschenkt bekommen, und die zweiten Lektüre denke ich mehr oder weniger in einem Zug zu vollenden, falls sich bei über 1.800 Seiten von einem solchen Zug überhaupt sprechen lässt.
Zur Entstehung ist anzumerken, dass es wohl ursprünglich eine Trilogie werden sollte, dreimal vier Monate, dass dann aber das dazwischen gekommen ist, was in den Kurzbiographien des Autors „eine Krise“ heißt und eine Zeit der Depression, der Paranoia und des Alkoholismus war. Und so erschien 1973 ein kurzer dritter Band und erst zehn Jahre später dann der abschließende vierte. Manche Kritiker wollten in dem stilistische Brüche entdeckt haben, als hätten sie zur Kritik des letzten die vorherigen tatsächlich noch einmal gelesen oder könnten sich an sie noch erinnern oder was. Es wird sich zeigen, was davon zu halten ist.
Das Roman hat mindestens vier Erzählebenen: Seine Jetztzeit bilden die 367 Tage vom 20. August 1967 bis zum 20. August 1968. Die hauptsächliche Erzählerin ist Gesine Cresspahl, am 3. März 1933 im fiktiven Jerichow in Mecklenburg geboren als Tochter des Tischlers Heinrich Cresspahl und seiner Frau Lisbeth, einer geborenen Papenbrock. Gesine lebt mit ihrer anfangs neunjährigen Tochter Marie seit sechs Jahren in New York. Sie arbeitet als Auslandskorrespondentin bei einer Bank und steht wohl vor einem Karrieresprung, der im Zusammenhang mit den politischen Reformen der Tschechoslowakei zu stehen scheint. Maries Vater ist jener Jakob, über den der Autor zuvor schon einige Mutmassungen niedergeschrieben hatte; überhaupt ist hervorzuheben, dass die Gesamtheit der sogenannten fiktionalen Texte Uwe Johnsons einen einzigen großen Zusammenhang bildet, den im Gedächtnis zu behalten nicht immer einfach ist. Jedenfalls bilden Gesines Leben und das ihrer Tochter die umfassende Erzählung des Romans.
Die zweite Ebene liefert die Erzählung Gesines von der Geschichte ihrer Eltern, die sie ihrer Tochter Marie erzählt, teils direkt, teils auf Tonband, „für wenn sie tot ist“. Gesines Vater Heinrich, Jahrgang 1888, hatte sich im August 1931, bereits wieder auf dem Weg nach England, wo er als Tischlermeister einen Betrieb leitete, in ein junges Mädchen verguckt: Lisbeth Papenbrock, 18 Jahre jünger als er, der er nach Jerichow folgt und mit der er rasch einig wird, dass sie sich heiraten. Sie gehen dann gemeinsam fort aus Deutschland, in dem der Aufstieg der Nazis schon zu begonnen hat, denen der halbe Sozialdemokrat Cresspahl den Willen nicht nur zur Abschaffung der Republik, sondern auch den zum Krieg schon anmerkt. Doch Lisbeth hat Heimweh, nicht nur nach ihrer Familie, sondern auch nach ihrer Mecklenburgischen Landeskirche, und so nutzt sie die bevorstehende Geburt ihres ersten (und letztlich einzigen) Kindes zur Flucht zurück nach Deutschland. Und Cresspahl folgt ihr, widerwillig, aber er folgt ihr und bleibt dort, wo er nur um ihretwillen lebt. Doch auch damit wird Lisbeth nicht glücklich.
Die dritte Ebene bildet die tägliche Zeitungslektüre Gesines: Jeden Tag erwirbt sie die New York Times, aus der heraus die jeweils aktuelle politische und gesellschaftliche Wirklichkeit in den Roman gelangen: der Rassenkonflikt, politische Umtriebe und Skandale, der Krieg in Viet Nam und die Proteste gegen ihn, die Mafia und die alltägliche Kriminalität schlechthin etc. pp. Diese Ebene bietet zum einen Anlass zur Auseinandersetzung zwischen Gesine und Marie, wobei Marie – die erstaunlich klug und redegewandt für ihr Alter ist – im Vergleich zu ihrer Mutter nicht nur einen amerikanischeren Standpunkt einnimmt, sondern aufgrund ihres Alters natürlich auch eine opportunistischere Grundhaltung zeigt.
Die vierte Ebene besteht aus zumeist kurzen Gedankendialogen Gesines mit Lebenden und Toten, in denen sich Gesine oft selbst in ein kritisches Licht setzt. Hier werden die Kompromisse deutlich, die sie eingeht, oft um ihrer Tochter willen, aber sie kritisiert auch ihre eigene Bequemlichkeit, ihre Furcht, als Ausländerin in den USA negativ aufzufallen, ihre Bindungsängste und vieles mehr.
Sowohl das New York des Jahres 1967 als auch das Mecklenburg der 30er Jahre zeichnen sich durch einen großen Reichtum an handelnden Personen aus, wobei es Johnson oft gelingt, eine Person auf wenigen Seiten markant zu charakterisieren. Wer sich einen kurzen Eindruck von Johnsons Erzählkunst verschaffen will, lese zum Beispiel die Charakterisierung des Jerichower Rechtsanwaltes Dr. Avenarius Kollmorgen auf den Seiten 305 ff. (17. November 1967).
Johnson reduziert das Erzählte zumeist auf das Notwendigste, liefert auch häufig zum Verständnis wesentliche Details erst später in anderen Zusammenhängen nach, so dass vom Leser ein gehöriges Maß an Aufmerksamkeit gefordert wird, um den komplexen Beziehungen der Figuren untereinander zu folgen. Dies wird ein wenig dadurch gemildert, dass ab und zu kurze Zusammenfassungen eingeschoben werden, die die Orientierung erleichtern. Auch sprachlich setzt der Text dem Leser einigen Widerstand entgegen: Neben vereinzelten Dialogen im Mecklenburger Platt, fallen heute besonders jene Stellen auf, an denen Johnson englische Wendungen ins Deutsche übersetzt, die heute als Amerikanismen geläufig sind; interessanterweise merkt man gerade an diesen Stellen dem Text am deutlichsten sein Alter an. Und auch sonst ist Johnsons Deutsch eher kantig als eingängig, was wohl als Abbildung eines Deutsch gelesen werden muss, das nicht nur mecklenburgische Wurzeln hat, sondern auch durch den jahrelangen Gebrauch des Englischen verändert wurde.
Der Roman liefert ein außergewöhnlich reiches und differenziertes Bild sowohl des Lebens im Deutschland der ersten Hälfte der 30er Jahre als auch im New York der 60er Jahre. Johnsons prinzipielles Misstrauen gegen Ideologien und eindimensionale Erklärungen sowie seine klare Haltung gegen Rassismus, Diktaturen und Unfreiheit bilden das Fundament der Erzählung, ohne dass der Autor seine Figuren, pardon, Personen mit dieser Grundhaltung überfrachtet. Johnson erzählt, soweit das überhaupt möglich ist, das Leben selbst. Es ist daher nicht verwunderlich, dass im vierten Band Theodor Fontane als Schirmherr dieses Romans herbeizitiert wird.
Was die derzeit verkaufte Kindle-Edition des Romans angeht, so sollte vielleicht nicht unerwähnt bleiben, dass Suhrkamp das Erstellen der betreffenden Dateien noch ein wenig üben muss: Bei Verwendung der sogenannten Verleger-Schriftart zeigt mein Kindle Paperwhite nur graphischen Müll an; bei Wahl einer anderen Schriftart wird auf dem Paperwhite nur Flattersatz angezeigt, während bei Anzeige über die App auf dem iPad die kursive Textauszeichnung komplett verloren geht. Zudem werden die meisten Gedankenstriche nur als Bindestriche dargestellt. Da Suhrkamp derzeit für eBooks nur 1 Cent weniger verlangt als für das entsprechende Taschenbuch, darf man als Käufer wohl ein wenig mehr Sorgfalt bei Herstellung und der Prüfung der Dateien erwarten.
Uwe Johnson: Jahrestage. Aus dem Leben der Gesine Cresspahl. August 1967 – Dezember 1967. Frankfurt: Suhrkamp, 1970. Leinen, Fadenheftung, 478 Seiten. Kindle-Edition. Berlin: Suhrkamp, 2013. 732 KB. 11,99 €.