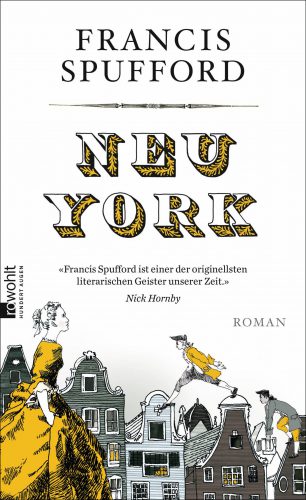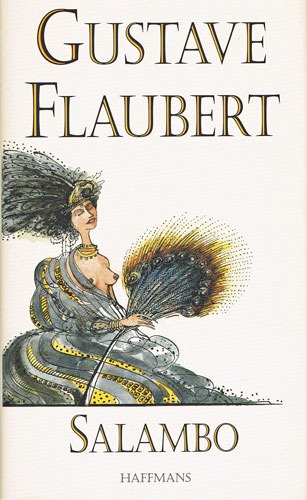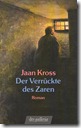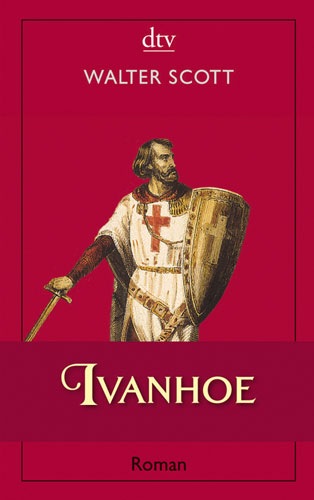»Nun«, sprach Rochefort, »das ist abermals so ein Zufall, der dem anderen die Stange halten kann. […]«
Dieser Fortsetzungsroman entstand 1844 unmittelbar vor „Der Graf von Monte Christo“, und fällt im direkten Vergleich mit diesem deutlich ab. Zwar nimmt das Buch im letzten Viertel deutlich an Fahrt auf, und seine Konstruktion wird subtiler, aber es erreicht nicht die dichte Verflechtung seines Personals in die zentrale Intrige (hier sind es am Ende gleich zwei Intrigen, die über die Strecke helfen müssen), die „Der Graf …“ auszeichnet. Es fehlt ein sich über den gesamten Text erstreckender Plan; der Mittelteil der Erzählung besteht in der Hauptmasse aus rein anekdotischem Füllstoff, der die Leser unter- und hinhalten soll, bis es Zeit ist, das durchaus furiose Ende auszupacken.
Mit „Die drei Musketiere“ liefert Dumas ein französisches Pendant zu dem in England von Walter Scott erfolgreich begründeten Historischen Roman, der eine sogenannte spannende Handlung vor einen historischen Hintergrund setzt, der den Lesern mehr oder weniger vertraut ist. Bei Dumas dient dazu die Regierungszeit Ludwig XIII., den er ganz traditionell als einen schwachen König unter der Fuchtel des intriganten Kardinals Richelieu vorführt. Der Handlungszeitraum sind die Jahre 1625 bis 1628; der zweite Teil der Handlung fällt in die Zeit der Belagerung von La Rochelle.
Im Zentrum der Handlung steht der junge Gascogner d’Artagnan, der sich aufmacht, um in Paris Musketier zu werden, und dessen hauptsächliche Charaktereigenschaft ist, sich bei jeder Gelegenheit zu duellieren. Auf diese Weise macht er auch Bekanntschaft mit dem titelgebenden Trio Athos, Porthos und Aramis, mit denen zusammen er sogleich in eine staatsumstürzende Intrige verwickelt wird. Besonders dieser erste Teil der Erzählung ist zahlreich verfilmt worden; auf eine Verfilmung des zweiten, dunkleren und voraussetzungsreicheren Teils hat man in der Regel klugerweise verzichtet. Allerdings muss man Dumas einräumen, dass seine Einbeziehung der Ermordung des Herzogs von Buckingham in die Handlung, so unwahrscheinlich seine Konstruktion auch immer sein mag, ein kleines schriftstellerisches Meisterstück bildet. Ansonsten ist auch diesem Buch die Geschwindigkeit anzumerken, mit der Dumas arbeiten musste, so dass es Flüchtigkeitsfehler – so wird etwa d’Artagnan gleich zweimal zum Musketier gemacht (S. 360 und 544) – bis in die Buchausgabe geschafft haben.
Dumas hat zu diesem Erfolgsroman gleich zwei Fortsetzungen von jeweils etwa gleicher Länge geliefert – „Zwang Jahre später“ (1845) und „Der Vicomte von Bragelonne“ (1847) –, mit denen er dem Interesse des Publikums des 19. Jahrhunderts an Historischen Romanen entgegenkam. Ob ich diese Teile, die ich nicht bereits gelesen habe, ebenfalls hier besprechen werde, ist derzeit noch nicht entschieden.
Es ist in jedem Fall zu empfehlen, „Die drei Musketiere“ vor oder mit einigem Abstand zu „Der Graf von Monte Christo“ zu lesen; man kann alternativ auch die Kapitel 29 bis 42 getrost querlesen, ohne viel zu versäumen. Auch dieser Ausgabe liegt die Übersetzung von August Zoller (1845) zugrunde, die hier ebenfalls modernisiert, aber nicht gekürzt wurde.
Alexandre Dumas: Die drei Musketiere. Aus dem Französischen von August Zoller. Neu überarbeitet von Michaela Meßner. dtv 14765 (Neuausgabe 2020). München: dtv, 22024. Broschur, 748 Seiten. 15,– €.