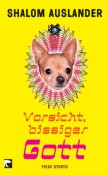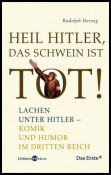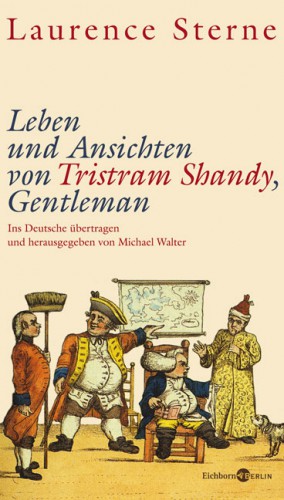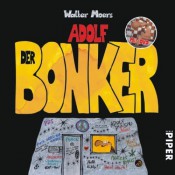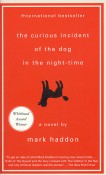Dieser humoristische Roman von P.G. Wodehouse stammt aus dem Jahr 1935 und liegt hier in der deutschen Erstübersetzung vor. Über Wodehouse im Allgemeinen und die in der Edition Epoca vorliegenden Übersetzungen durch Thomas Schlachter habe ich anlässlich von »Onkel Dynamit« schon einiges geschrieben, das nicht wiederholt zu werden braucht. »Monty im Glück« (»The Luck of the Bodkins«) ist nach »Heavy Weather« der zweite Roman von Wodehouse, in dem Montague »Monty« Bodkin als Protagonist auftritt. Monty gehört in das Umfeld des Londoner Drones Clubs, in dem, neben anderen, auch Wodehouse’ bekannteste Figur Bertie Wooster und Pongo Twistleton (vgl. »Onkel Dynamit«) Mitglieder sind.
Dieser humoristische Roman von P.G. Wodehouse stammt aus dem Jahr 1935 und liegt hier in der deutschen Erstübersetzung vor. Über Wodehouse im Allgemeinen und die in der Edition Epoca vorliegenden Übersetzungen durch Thomas Schlachter habe ich anlässlich von »Onkel Dynamit« schon einiges geschrieben, das nicht wiederholt zu werden braucht. »Monty im Glück« (»The Luck of the Bodkins«) ist nach »Heavy Weather« der zweite Roman von Wodehouse, in dem Montague »Monty« Bodkin als Protagonist auftritt. Monty gehört in das Umfeld des Londoner Drones Clubs, in dem, neben anderen, auch Wodehouse’ bekannteste Figur Bertie Wooster und Pongo Twistleton (vgl. »Onkel Dynamit«) Mitglieder sind.
»Monty im Glück« spielt aber in der Hauptsache weit entfernt von London, nämlich auf der Überfahrt des Passagierschiffs R.M.S. Atlantic von Europa nach New York. Monty nimmt an der Überfahrt nicht teil, weil er nach Amerika will, sondern ausschließlich, weil sich seine Verlobte Gertrude Butterwick auf dem Schiff befindet, die als Mitglied der englischen Damenhockey-Nationalmannschaft auf dem Weg in die Vereinigten Staaten ist.
Gertrude hat Monty kurz vor Abfahrt des Schiffes aus für ihn vorerst unerfindlichen Gründen die Verlobung aufgekündigt, womit Monty durchaus nicht einverstanden ist. Es stellt sich auch nur zu bald heraus, dass alles auf einem Missverständnis beruht, und die Verlobung ist rasch wiederhergestellt. Könnte sich Monty nun in aller Stille entfernen, hätte das Buch ein vorzeitiges Ende gefunden, aber durch die gemeinsame Überfahrt für sechs Tage auf engstem gesellschaftlichen Raum aneinander gefesselt, findet Gertrude problemlos weitere Anlässe für immer erneute Auflösungen des Verlöbnisses, wobei sich die Lage von Mal zu Mal zu dramatisiert. Der allzu ängstliche Leser darf sich aber angesichts des Titels über den letztendlichen Ausgang beruhigen. Auch für die Brüder Reginald und Ambrose Tennyson, seines Zeichens minder begabter Schriftsteller, der irrtümlich für Alfred, Lord Tennyson gehalten wird, die sich um Mabel Spence, die Schwägerin des Filmmoguls Ivor Llewellyn, der von seiner Gattin genötigt wird, ein Perlenkollier am US-amerikanischen Zoll vorbeizuschmuggeln, bzw. um die Schauspielerin Lottie Blossom bemühen, geht die Geschichte letztlich gut aus, ganz zu schweigen von Albert Peasemarch. (Dieser Satz wurde in der Absicht konstruiert, die Schlichtheit der zwischenmenschlichen Beziehungen dieses Romans aufscheinen zu lassen.) Mit anderen Worten:
Männer sind in dieser Beziehung einfach goldig. Man kann sie wie den letzten Dreck behandeln, doch wenn’s auf die Schlußumarmung mit Abblende zugeht, ist auf ihre putzmuntere Präsenz Verlaß.
»Monty im Glück« zeigt Wodehouse einmal mehr als brillanten Konstrukteur von Komödien auf abgezirkeltem Raum und mit klar begrenztem Personal. Auch dieser Roman könnte, so wie er ist, als Vorlage für eine klassische Screwball-Komödie dienen. Alle Konflikte, Wendungen und Irrungen sind von langer Hand vorbereitet und bedingen einander mustergültig. Alle eingeführten Figuren verfolgen ihre eigenen Absichten und tragen zugleich zur Verwirrung des großen Ganzen bei, und je besser ein Plan zur Lösung eines Konflikts ausgedacht ist, desto sicherer erzeugt er die nächste Stufe des Chaos. Und ganz en passant stellt Wodehouse auch hier wieder seine Meisterschaft des ebenso lakonischen wie pointierten Dialogs unter Beweis:
»Ich könnte einfach nicht schauspielern. Ich käme mir furchtbar bescheuert vor.«
»Tun Sie das nicht ohnehin?«
»Doch, aber nicht auf diese Art.«
Ein Buch für alle, die gut geschriebene Unterhaltung zu schätzen wissen.
P.G. Wodehouse: »Monty im Glück«. Aus dem Englischen von Thomas Schlachter. Zürich: Edition Epoca, 2005. Pappband, Fadenheftung, 351 Seiten. 22,90 €.