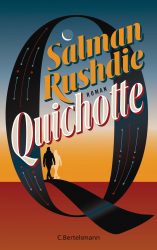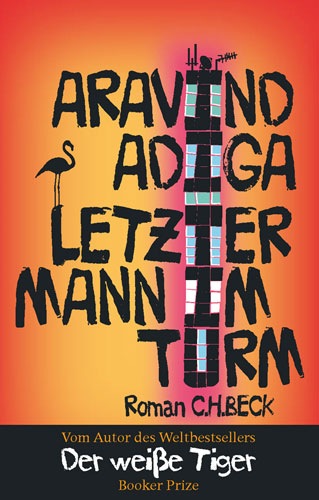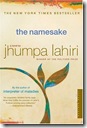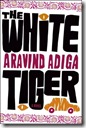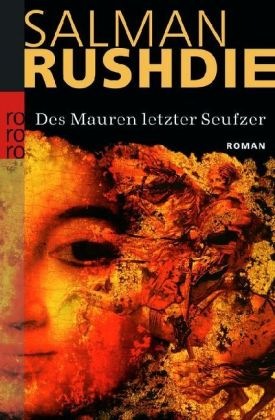Dhanajaya Rajaratnam, genannt Danny, ist ein Tamile, der ohne Aufenthaltsgenehmigung in Sydney lebt. Er stammt aus Sri Lanka, war auch schon einmal in Dubai beschäftigt und ist als Student nach Australien gekommen. Das College, an dem er studieren sollte, erwies sich aber als eine schlecht getarnte Schleuser-Organisation, die sich an den Studiengebühren der Ausländer bereichert und ihnen im Gegenzug nur fragwürdige Diplome anbieten konnte. Danny hat dieses Studium bald aufgegeben und sich als Putzmann selbstständig gemacht. Er lebt nun seit vier Jahren in Australien, und die meiste Zeit gelingt es ihm, in aller Öffentlichkeit unsichtbar zu bleiben. Doch an dem Tag, von dem Amnestie erzählt, läuft Danny beinahe in eine Morduntersuchung hinein. Eine der Bewohnerinnen im Haus gegenüber dem, in dem er die Wohnung eines Anwaltes putzt, ist ermordet worden. Danny ahnt nicht nur sofort, dass er die Ermordete kennt, er hat auch einen starken Verdacht, wer der Mörder sein könnte.
Das Mordopfer Radha und ihr mutmaßlicher Mörder Prakash waren ein Liebespaar, zusammengehalten durch die gemeinsame Spielsucht und überhaupt ihre Sehnsucht, sich selbst zu spüren. Danny putzte bei Rahda, die versprach sich für ihn einzusetzen und ihm eine Aufenthaltsgenehmigung oder wenigstens einen Straferlass zu verschaffen. Danny wurde zum regelmäßigen Begleiter bei den Ausflügen des Paares in Kneipen und Spielhallen. Und Danny erfährt auch, dass der Mord an einer Stelle geschehen ist, die das Paar schon des Öfteren aufgesucht hatte. Danny begeht nun den Fehler – und das ist die einzige wirkliche Crux der Fabel – diesen mutmaßlichen Mörder anzurufen, der sofort ahnt, dass Danny ihn verdächtigt. Von diesem Moment an liefern sich beide eine Art von Katz-und-Maus-Spiel, dessen Verlauf und Ausgang hier nicht verraten werden müssen.
Parallel zu diesem einen Tag wird uns nicht nur die Geschichte Dannys in den vier Jahren in Australien erzählt, sondern wenigstens in Teilen seine übrige Lebensgeschichte seit seiner Kindheit in Batticaloa in Sri Lanka. Danny ist ein überdurchschnittlich intelligenter, sogar gebildeter junger Mann, der in Europa wahrscheinlich eine gute akademische Ausbildung bekommen und eine erfolgreiche Karriere angestrebt hätte. Doch in Sydney ist er nur Opfer all jener, die seine Furcht vor Internierung und Deportation ausnutzen.
Der Roman braucht eine Weile, um das richtige Tempo zu finden. Lange Zeit kann man den Verdacht hegen, das alles sei zwar präzise recherchiert, aber kaum originell und unterscheide sich nicht wesentlich von etlichen Dokumentationen, die es inzwischen zu sogenannten Illegalen in der westlichen Welt gibt. Erst die Zuspitzung des psychologischen Duells zwischen Danny und Prakash hilft der etwas zu berechenbaren politischen Ebene des Romans auf.
Alles in allem ein passables Buch zwischen politischer Botschaft und Psycho-Krimi, aber man sollte keinen zweiten Weißen Tiger erwarten.
Aravind Adiga: Amnestie. Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. München: Beck, 2020. Pappband, 286 Seiten. 24,– €.