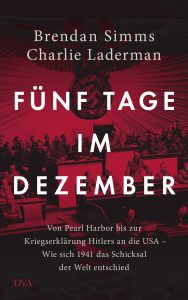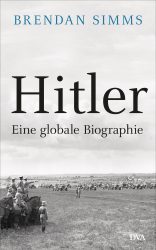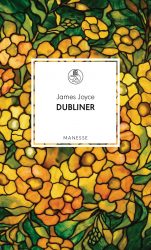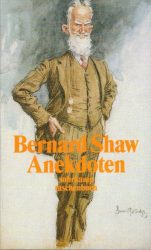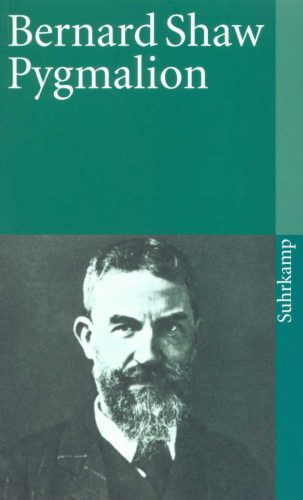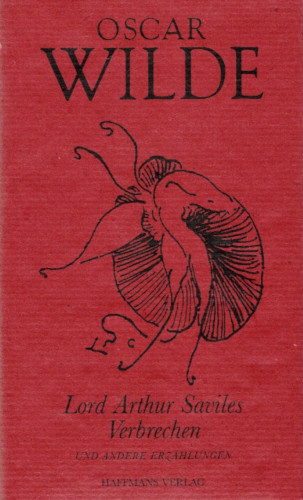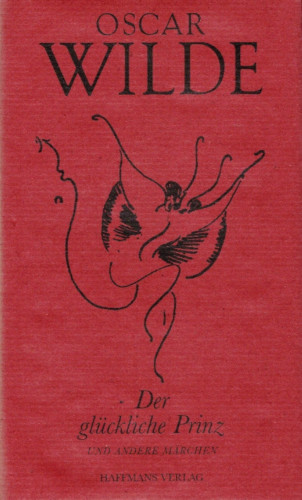Es gibt einige Autoren, bei denen es sinnvoll ist, sich einer Art von Reiseführer zu bedienen, um ihr Werk zu erkunden; Joyce gehört sicherlich zu ihnen. Joyce hatte von Anfang an und je länger je mehr eine besondere Auffassung von der Funktion poetischer Sprache, ein Bewusstsein dafür, dass Sprache in gewisser Weise unsere Wahrnehmung der Welt mitbestimmt und die Verwendung eines bestimmtem Stils – sei er etwa romantisch, idealistisch oder realistisch – einen ebenso bestimmten Blick auf die Welt zu erzeugen vermag. Er selbst fand in sich eine Souveränität in der Verfügung über diese Stile und Stilebenen vor, ein Verfügen über die Sprache und Sprachen, und so schrieb er sein vermutlich wichtigstes Buch Ulysses von diesem Standpunkt der sprachlichen Vielfalt aus: Der Inhalt des Buches hatte sich der Sprache des bzw. den Sprachen der Erzähler anzupassen, nicht umgekehrt, und das große Kunststück war es, dennoch einen Roman daraus entstehen zu lassen.
Da die meisten Leser von diesem Verfahren wenig ahnen, wenn sie beginnen, den Ulysses zu lesen, scheitern die meisten; sehr oft im dritten Kapitel, in dem Stephen Dedalus am Strand spazieren geht und über die unumgehbare Visualität der Welt philosophiert – ihm ist am Tag zuvor seine Brille zerbrochen, aber das erführe der Leser erst viel, viel später im Buch, wenn er denn nicht hier und jetzt aufgeben würde –, und der unbedarfte Leser weder begreift, was er da liest (was auch gar nicht so wichtig ist; wichtig ist viel mehr, Stephen als einen studierten Philosophen vorzuführen, der auf konkrete Probleme mit sehr abstrakten Gedanken zu reagieren neigt) geschweige denn, warum er das lesen soll.
Nun ist Joyce keiner jener freundlichen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, die ihre Leser an der Hand nehmen und durch den Roman führen, sie auf dies aufmerksam machen, ihnen jenes erklären, ihnen bei einem Dritten nahelegen, es sich gut zu merken, denn er werde es später noch einmal gebrauchen können. Bei Joyce stürzt der Roman auf uns ein wie eine neue Welt, vieles kommt gleichzeitig und das meiste fügt sich erst sehr viel später zu einem sinnvollen Gebilde. Und aus all diesen Gründen ist es nützlich, sich vor der Lektüre der Joyceschen Werke zuerst einmal eine kurze Einführung einzuführen.
Eine dieser Einführungen hat der Joyce-Kenner und -Übersetzer Friedhelm Rathjen nun erneut im eigenen Verlag aufgelegt. Das Buch ist eine Überarbeitung der im Jahr 2004 bei Rowohlt erscheinen Bild-Monographie mit dem Vorteil, dass die Neuausgabe die Lebensbeschreibung und die Einführung ins Werk entzerrt und sie auf diese Weise leichter einer gezielten Lektüre dienen kann. Nach einer für den Einstieg vollständig ausreichenden Biographie, die zugleich auch die Entwicklung der Joyceschen Ästhetik nachzeichnet, folgen Kapitel zu einzelnen Werken, wobei auch eher unbekannten wie dem frühen Gedichtband Kammermusik oder auch dem Text Giacomo Joyce eigene Abschnitte gewidmet sind. Dabei ist allen Werkbesprechungen zu eigen, dass sie nur behutsame Hinweise geben, ohne einer selbstständigen Lektüre im Weg zu stehen.
Allen, die einen ersten Überblick über Joyce gewinnen wollen, bevor sie sich in das Abenteuer der Lektüre dieses Weltautors stürzen, sei der Band anempfohlen.
Friedhelm Rathjen: Joyce. Einführung in Leben und Werk. Südwesthörn: Ǝdition RejoycE, 2023. Bedruckte Broschur, 152 Seiten. 17,– €. Bestellung per E-Mail direkt beim Verlag.