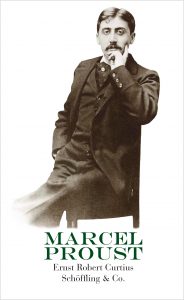Pünktlich zu meiner Wiederbeschäftigung mit »Moby-Dick« bringt die »Neue Rundschau« ein passendes Themenheft. Es präsentiert 12 Kommentare unterschiedlicher Autoren zu einzelnen Kapiteln des Romans als Auftakt zu einer ständigen Kolumne, die in den nächsten Jahren Kommentare zu allen 135 Kapiteln versammeln soll. Ein solches Kommentar-Projekt erscheint auf den ersten Blick wunderlich, aber natürlich bietet sich gerade »Moby-Dick« als Objekt für einen solchen Kommentar an, da für Melville die Kapitel offensichtlich ein wichtiges, wenn nicht das zentrale Ordnungssystem des Romans darstellten. Die Einleitung bezeichnet das Projekt als einen »historisch-spekulativen Kommentar«. Nach der Lektüre der ersten Beispiele neige ich dazu, die gelieferten Texte nur bedingt als Kommentare, sondern vielmehr als Interpretationen aufzufassen. Selbstverständlich sind die Grenzen fließend, aber die Texte sind insgesamt deutlich mehr deutend als erläuternd. Doch dazu später noch ein paar Sätze.
Pünktlich zu meiner Wiederbeschäftigung mit »Moby-Dick« bringt die »Neue Rundschau« ein passendes Themenheft. Es präsentiert 12 Kommentare unterschiedlicher Autoren zu einzelnen Kapiteln des Romans als Auftakt zu einer ständigen Kolumne, die in den nächsten Jahren Kommentare zu allen 135 Kapiteln versammeln soll. Ein solches Kommentar-Projekt erscheint auf den ersten Blick wunderlich, aber natürlich bietet sich gerade »Moby-Dick« als Objekt für einen solchen Kommentar an, da für Melville die Kapitel offensichtlich ein wichtiges, wenn nicht das zentrale Ordnungssystem des Romans darstellten. Die Einleitung bezeichnet das Projekt als einen »historisch-spekulativen Kommentar«. Nach der Lektüre der ersten Beispiele neige ich dazu, die gelieferten Texte nur bedingt als Kommentare, sondern vielmehr als Interpretationen aufzufassen. Selbstverständlich sind die Grenzen fließend, aber die Texte sind insgesamt deutlich mehr deutend als erläuternd. Doch dazu später noch ein paar Sätze.
Außer den sich sowieso aus dem hermeneutischen Zirkel ergebenden, hat ein solches Projekt offensichtlich mit zusätzlichen Schwierigkeiten zu kämpfen: Die erste resultiert aus der unterschiedlichen Länge der Kapitel, die zwischen 1 und 27 Seiten schwankt. Es besteht daher die Gefahr, dass der Interpret bei kurzen Kapitel zur Überinterpretation neigt, um eine angemessene Menge an Kommentar liefern zu können. Eine andere Gefahr besteht offenbar darin, dass übergreifende Motive oder weit von einander entfernte Stellen, die einander erhellen oder konterkarieren, unterbewertet oder übersehen werden könnten, wenn das die Interpretation hauptsächlich leitende Ordnungssystem die Kapitelstruktur ist. Auch ist die Kapiteleinteilung durch den Roman hindurch durchaus nicht gleichmäßig: Während manche Kapitel offensichtlich als für sich allein stehend konzipiert wurden, bilden andere ebenso offensichtlich Gruppen oder nähern sich dem Erzählfluss traditionellen Erzählens an. Aber nehmen wird zugunsten der Interpreten an, dass sie sich all der Schwierigkeiten im Großen und Ganzen ausreichend bewusst sind. Mildernde Umstände ergeben sich natürlich auch daraus, dass keine Interpretation der Weisheit letzten Schluss darstellen muss, sondern immer nur einen Versuch liefert, den Widerstand, den ein Text unserem Begreifen und Durchdringen entgegenstellt, zu überwinden oder wenigstens abzuschwächen.
Wie schon angedeutet, handelt es sich bei den Texten weniger um erläuternde Kommentare, sondern mehr um deutende Interpretationen. Dabei herrschen zwei methodische Zugriffe vor:
1. Der Interpret nimmt zu Melvilles »Moby-Dick« einen anderen Text oder Autor hinzu, den er auch gelesen hat, und schaut, was Melville und was der andere Autor so ungefähr gesagt haben und vergleicht dann miteinander. Bereits 1804 hat Jean Paul zu diesem Verfahren eine methodologische Einschätzung geliefert:
Ich berufe mich auf ihre zwei verschiedene Wege, nichts zu sagen. Der erste ist der des Parallelismus, auf welchem Reinhold, Schiller und andere ebensooft auch Systeme darstellen; man hält nämlich den Gegenstand, anstatt ihn absolut zu konstruieren, an irgendeinen zweiten (in unserm Falle Dichtkunst etwa an Philosophie, oder an bildende und zeichnende Künste) und vergleicht willkürliche Merkmale so unnütz hin und her, als es z. B. sein würde, wenn man von der Tanzkunst durch die Vergleichung mit der Fechtkunst einige Begriffe beibringen wollte und deswegen bemerkte, die eine rege mehr die Füße, die andere mehr die Arme, jene sich nur mehr in krummen, diese mehr in geraden Linien, jene für, diese gegen einen Menschen etc. Ins Unendliche reichen diese Vergleichungen, und am Ende ist man nicht einmal beim Anfange. (Vorschule der Ästhetik)
Seitdem hat die Methode unter dem Schlagwort Intertextualität extrem an Prominenz gewonnen.
2. Der Interpret sucht sich aus der Menge der im Kapitel vorhandenen strukturellen Merkmale ein oder zwei heraus, zu denen ihm ein Gedanke einfällt. Nun entwickelt er diesen Einfall über einige Seiten hinweg und zieht dabei alles heran, was in dem verhandelten Kapitel seinen Einfall irgendwie stützen könnte, und lässt alles fort, was darauf hinweisen könnte, dass sein Einfall zur Erhellung des Kapitels eher weniger beiträgt. Auch diese Methode begreift man besser am konkreten Beispiel.
So beschäftigt sich Ethel Matala de Mazza mit dem Kapitel 15 »Chowder« (Chowder ist eine Art Fischsuppe): Ishmael und Queequeg kehren, gerade in Nantucket angekommen, im Hotel »Trankessel« ein, das ihnen ihr Wirt in New Bedford empfohlen hat. Bereits das Wirtshaus-Schild weist auf eine Besonderheit dieser Herberge hin:
Zwei gewaltige hölzerne Kessel, schwarzgestrichen und aufgehängt an Eselsohren, schwangen von den Quersalings einer alten Bramstege, aufgepflanzt vor einem alten Torweg. (Übersetzt von Friedhelm Rathjen.)
Die beiden Kessel bilden fast so etwas wie die Speisekarte des Hotels, denn offenbar finden sich ihre metallenen Pendants in der Küche, so dass der Gast bei jeder Mahlzeit die Auswahl zwischen zwei Gerichten hat; im Fall von Ishmael und Queequeg heißt die Alternative »Miesmuschel oder Kabeljau?« Nun fällt der Interpretin bei der Lektüre folgendes auf: Der ganze erste Teil des »Moby-Dick« erzählt eine Abfolge von Entscheidungen Ishmaels, die unter immer enger werdenden Bedingungen schließlich dazu führen, dass er sich in eine Lage begibt, in der nicht mehr er selbst, sondern ein anderer, Ahab, für ihn die Entscheidungen trifft. Während ihm zu Anfang die ganze Welt offen zu stehen scheint, ist er mit dem Ablegen der Pequod einem Schicksal ausgeliefert, über das er nicht einmal mehr illusionär Herr ist. Frau Matala de Mazza möchte nun das Kapitel »Chowder« zu einem entscheidenden Gelenk in dieser Entwicklung machen, indem sie erklärt, hier habe Ishmael zum letzten Mal eine freie, wenn auch wenig relevante Wahl, während sein weiteres Vorgehen vom Schicksal, seinem Unbewussten oder was auch immer (die Interpretin mag sich da verständlicherweise nicht konkret festlegen) schon wesentlich beschränkt sei.
Nun ist natürlich die grundlegende Idee der Interpretin richtig und weist auf eine wichtige Struktur des Buches hin. Nur erzwingt der Einfall, dies gerade am Kapitel »Chowder« zeigen zu wollen, eine Missachtung des Textes, so wie Melville ihn geschrieben hat: Denn nachdem sich Ishmael im »Trankessel« zwischen zwei Gerichten entscheiden muss, stehen ihm nachher drei Schiffe für die Ausfahrt zum Walfang zur Auswahl. Melville hatte offensichtlich nicht den Einfall einer konsequent immer kleiner werdenden Anzahl von Möglichkeiten für Ishmael, sondern ihm genügte die allgemeinere Struktur. Frau Matala de Mazza dagegen muss die explizit auf zwei reduzierte Anzahl der Töpfe in der Küche des »Trankessels« ignorieren und von einer Vielzahl möglicher Fischgerichte faseln, um ihren Einfall zur Kommentierung des Kapitels 15 durchzusetzen. Ein solches Ignorieren vorhandener, aber im Gang der Interpretation störender Textstrukturen ist nahezu durchgängig zu beobachten.
Von dem Kollegen, der durch die Lektüre des »Moby-Dick« zu der Erkenntnis gekommen sein will, dass sich Pottwale von Krill ernähren und ähnlichem Unfug, der weder den Herausgebern noch den Redakteuren des Heftes hätte entgehen dürfen, will ich ganz schweigen.
Insgesamt eine Enttäuschung, die sich aber nahtlos in meinen allgemeinen Eindruck der deutschen Literaturwissenschaft einfügt. Ich werde das Projekt wenigstens in nächster Zeit weiter beobachten, denn man weiß ja nie …
Neue Rundschau, Jahrgang 123 (2012), Heft 2: Moby-Dick. Frankfurt/M.: Fischer, 2012. Broschur, 206 Seiten. 12,– €.