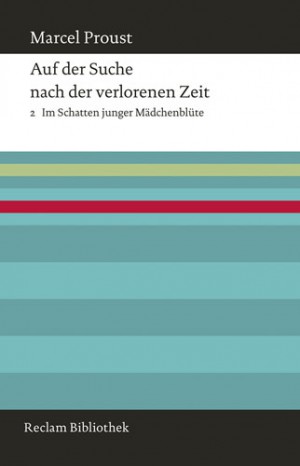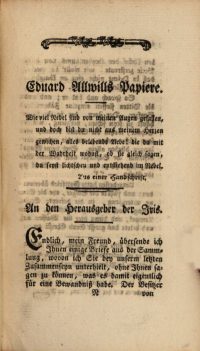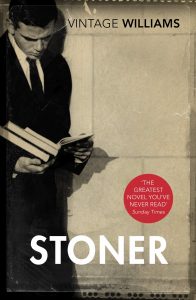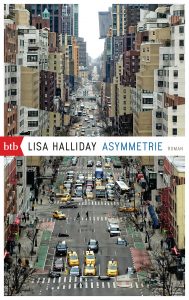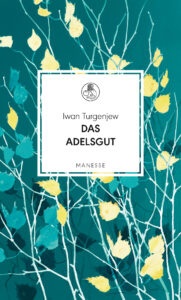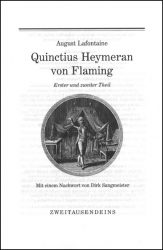Am anderen Morgen ging das Leben weiter in gewohnter Weise. Am folgenden wieder so, und so weiter; und es fiel gar nichts Besonderes vor.
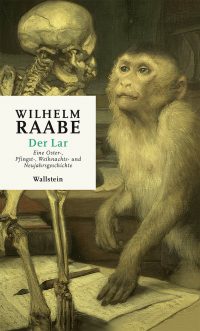
Ein ganz leichter und wundervoller Roman, den Raabe zwischen dem dunklen „Das Odfeld“ (1888) und dem anspruchsvollen „Stopfkuchen“ (1890/91) geschrieben hat. Als Motto zitiert er wohl aus einem Leserbrief an ihn: »O bitte, schreiben auch Sie doch wieder mal ein Buch, in welchem sie sich kriegen!« Und um den Leser gar nicht lange warten zu lassen, verrät er gleich auf der ersten Seite, wer sich kriegt und dass die Beiden Eltern eines gesunden Jungen werden.
Mit dieser Versicherung im Hintergrund erzählt Raabe die Geschichte vierer Figuren: dem etwas verlotterten Paul Warnefried Kohl, seiner Jungendfreundin Rosine Müller, seines Paten Franz de Paula Schnarrwergk und seines einzigen Freundes Bogislaus Blech, der den Roman als Maler betritt, sich dann aber rasch zum Photographen wandelt. Schnarrwergk, ein eingefleischter Junggeselle, der einstmals in Warnefrieds Mutter verliebt war, die sich dann aber vom Germanistikprofessor Kohl hat heiraten lassen, besitzt den titelgebenden Hausgeist (Lar), einen ausgestopften Affen, von dem der Leser nie die konkrete Art erfährt und der als stummer Zeuge besonders des letzten Viertels des Romans dient.
Bis dahin geschieht in etwa folgendes: Nach dem Tod von Warnefrieds Mutter wird der elterliche Haushalt der Kohls aufgelöst, um die verblieben Mietschulden zu zahlen. Am selben Tag ziehen Rosine Müller, die eine junge Freundin von Warnefrieds Mutter war, und der ehemalige Kreisveterinär Schnarrwergk zufällig im selben Stockwerk des selben Hauses ein. Warnefried hilft ein wenig beim Umziehen, zieht dann aber mittellos in die Welt hinaus, wird Student, der aus dem geringen wissenschaftlichen Renommee seines Vaters Kapital zieht und sich so durchs Studium schlägt, um fünf Jahre später als Doktor der Philosophie in die Heimatstadt zurückzukehren. Diese Entwicklung wird in nur wenigen Zeilen zusammengefasst.
Wieder daheim findet er, wie schon gesagt, seinen Freund Bogislaus vom Portrait-Maler zum Leichen-Photographen gewandelt, der aber nun auch in derselben Straße residieret wie Rosine und Schnarrwergk. Diese beiden Nachbarn sind inzwischen gut miteinander befreundet, hauptsächlich wegen eines verregneten Pfingstspaziergangs. Warnefried wird Journalist, da er ein schriftstellerisches Talent für Mord- und Sensationsgeschichten hat, und dann wird es auch schon Weihnachten. Schnarrwergk erleidet auf dem Weihnachtsmarkt einen Schlaganfall, wird von Warnefried nach Hause gebracht und dort zusammen mit der Nachbarin Rosine wieder gesund gepflegt. Dass „sie sich kriegen“, wurde ja oben schon gesagt; und auch Bogislaus bleibt nicht außen vor, sondern nimmt in der Ehe der Kohls nun jene Stelle ein, die Schnarrwergk zuvor im Hause der Eltern Kohl inne hatte.
Wie man sieht, erzählt das Buch eigentlich nichts; besonders das letzte Viertel schafft es, die Handlung, die ohnehin schon nicht sehr üppig war, noch einmal drastisch zu reduzieren. Auch werden jene spannenden oder gefühligen Szenen, mit denen die Trivialliteratur der Zeit auf die Herzmuskeln oder Tränendrüsen der Leserinnen abzielte, gar nicht auserzählt: Die Verlobung geschieht ganz nebenbei, vom kranken Scharrwergk wird uns gleich mehrfach versichert, dass er wieder auf die Beine kommen wird, die Hochzeit bleibt ganz außen vor und was der Sachen mehr sind. Auch als Entwicklungsroman taugt der Text nicht: Bogislaus und Warnefried werden undramatisch auf den Boden der ökonomischen Realität geholt, Rosine bleibt sich schlicht gleich und der knurrige Schnarrwergk war am Ende auch immer schon ein Herzensmensch.
Und dennoch sind die 200 Seiten ganz und gar gelungen. Da zeigt ein Meister, was Trivialliteratur sein könnte, wenn sie nur nicht so trivial wäre.
Wilhelm Raabe: Der Lar. Eine Oster-, Pfingst-, Weihnachts- und Neujahrsgeschichte. In: Werke. Kritische kommentierte Ausgabe. Göttingen: Wallstein, 2025. Pappband, Fadenheftung, 287 Seiten. 26,– €.