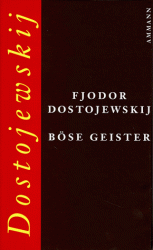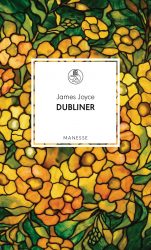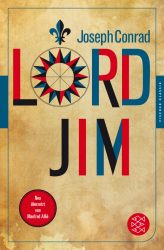Kurz, alles war sehr unklar, sogar verdächtig.
Im Jahr 1872, bald nach Dostojewskijs Rückkehr nach Russland aus Westeuropa, wohin er 1867 vor seiner drückenden Schuldenlast geflohen war, erschien der vierte seiner letzten sechs Romane. Die deutschen Übersetzungen tragen in diesem Fall ungewöhnlich viele verschiedene Titel, von dem wohl bekanntesten Die Dämonen über Die Besessenen und Die Teufel bis zu den Bösen Geistern der hier besprochenen Übersetzung von Swetlana Geier aus dem Jahr 1998. Der Titel bezieht sich auf eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium (8, 32–36), an der Jesus eine Zahl böser Geister aus einem Besessenen austreibt und in eine Herde Schweine bannt, die sich daraufhin in einen nahegelegenen See stürzt und sich selbst ersäuft. Dostojewskij, respektive sein Ich-Erzähler und Chronist des Buches, der Beamte Anton Lawrentjewitsch – der Leser erfährt seinen Nachnamen nicht – setzt diese Stelle als Motto an den Anfang des Buches. Sie fügt dem Roman neben den ohnehin reichhaltig vorhandenen Interpretationsansätzen einen weiteren, selbst schon vieldeutigen hinzu.
Die Haupthandlung spielt in der russischen Provinz während der 1870er Jahre. Der Roman beginnt allerdings mit der Erzählung des Lebens des Gelehrten Stepan Trofimowitsch Werchowenskij, der kurzzeitig als Hochschul-Dozent tätig war, den Hauptteil seiner Karriere aber als Hauslehrer und später Vertrauter im Haushalt der Generalswitwe Warwara Petrowna Stawrogina verbracht hat. Er gilt als ein kritischer und scharfer Kopf, was aber mehr an der bürgerlichen Harmlosigkeit seiner Umgebung liegt als an seinem übermäßig scharfen Verstand. Er stellt im Gegenteil eine recht böse Satire sowohl auf das gesellschaftliche als auch das politische Klima im Russland Mitte des 19. Jahrhunderts dar. Stepan Trofimowitsch ist ein etwas wirrer, von der französischen Aufklärung durchtränkter Schwätzer, der als Einäugiger unter Blinden den intellektuellen König gibt.
Das erste Drittel des Romans erschöpft sich nach der Schilderung des frühen Lebens und Wirkens Stepan Trofimowitschs weitgehend in einer Schilderung des provinziellen Lebens der oberen Hundert einer Gouvernements-Hauptstadt. Etwas Tempo kommt erst in den Roman als die Generation der Kinder Warwara Petrownas und Stepan Trofimowitschs auftaucht, um die herum die weitere Handlung konstruiert wird. Nikolaj Wsewolodowitsch Stawrogin erweist sich als ein ausschweifender Nihilist, der letztlich aber doch immer wieder mit seinem Gewissen kämpft. Pjotr Stepanowitsch Werchowenskij ist dagegen der staatsumstürzlerische Revolutionär, der im Laufe des Romans eine gewaltige Menge dummes Zeug reden darf – nur darin erweist er sich ganz als Sohn seines Vaters. Beide haben eine gemeinsame Vorgeschichte als sie im Roman auftauchen, waren zeitgleich in Westeuropa unterwegs und tauchen nun aus vorerst unklaren Gründen in der Stadt ihrer Eltern auf.
Werchowenskij gehört bald zum Hofstaat der Frau des Gouverneurs, unterhält aber auch intensive Kontakte zur kleinbürgerlichen Schicht der Stadt, in der er eine Fünfergruppe organisiert, die er als eine von unzähligen revolutionären Zellen ausgibt, die alle zusammen in naher Zukunft das politische Chaos und damit den Staatsumsturz herbeiführen sollen. Das eigentliche Ziel seiner zahlreichen Aktivitäten ist aber die Ermordung des Studenten Schatow, der einst der geheimen Organisation angehört hatte, sich nun aber losgesagt hat und als potentieller Verräter beseitigt werden soll. Stawrogin dagegen hat private Probleme: Er hat sich aus einer Laune heraus heimlich mit der geisteskranken Schwester eines lokalen Alkoholikers verheiratet, ist allerdings in eine andere Frau – Jelisaweta Nikolajewna Tuschina – verliebt, hat eine mehr als brüderliche Beziehung zu der Ziehtochter seiner Mutter – Darja Pawlowna Schatowa, der Schwester des Studenten, der ermordet werden soll – und außerdem eine Vorgeschichte, die ihm schwer auf dem Gewissen liegt. Eigentlich möchte Stawrogin ein ganz harter Kerl sein, aber tatsächlich erweist er sich wie so viele der später aus ihm entwickelten Abziehbilder als ein sentimentaler, selbstmitleidiger Bursche, der seine Ängste und Leidenschaften nicht unter Kontrolle zu halten versteht.
Dieser Ausgangskonflikt – der sich wohlgemerkt überhaupt erst in der Mitte des über 900-seitigen Romans langsam abzeichnet – wird auf durchaus beeindruckende Weise durchgearbeitet und wenigstens zum Teil zum Ende geführt. Wie immer geht es Dostojewskij aber wesentlich nicht um die konkrete Handlung, sondern um den Konflikt der europäischen Geistesströmungen seiner Zeit, ihrem Gegensatz zum orthodox-christlichen Russland der historischen Tradition – von dem nirgends auch nur erwogen wird, ob es denn jemals irgendwo oder irgendwann existiert hat – und der fatalen Lage, in die sie die europäische Kultur allgemein und das Russische Reich im Besonderen gebracht haben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Roman nicht nur mit der Lebensgeschichte Stepan Trofimowitschs beginnt, sondern auch mit seiner Verwandlung in einen evangelistischen Don Quixote endet.
Erzählerisch ein erstaunliches Meisterstück, das mit einem unglaublich langsamen Beginn zu einem furiosen Ende mit zahlreichen Toten gelangt, zugleich eine hübsche Satire auf das provinzielle Russland seiner Zeit und ein besorgtes Manifest zur Säkularisierung und Trivialisierung der Welt des 19. Jahrhunderts. Vielen heutigen Lesern wird der Roman unrettbar zu lang sein, anderen ideologisch zu fragwürdig, aber trotz aller Berechtigung solcher Bedenken rate ich allen ernsthaften Lesern, sich auf dieses Buch einzulassen.
Fjodor Dostojewskij: Böse Geister. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Zürich: Ammann, 21998. Leinenband, Fadenheftung, Lesebändchen, 967 Seiten. Lieferbar als Fischer Taschenbuch für 17,– €.