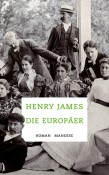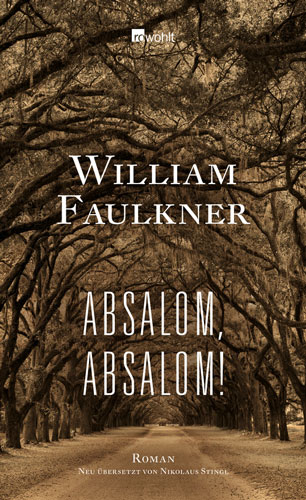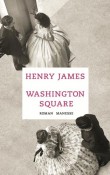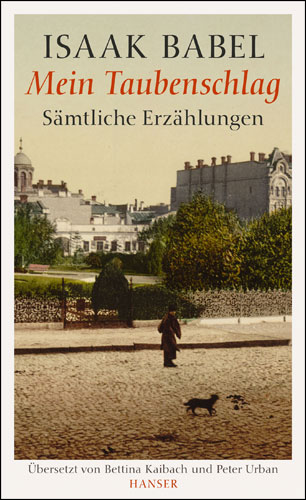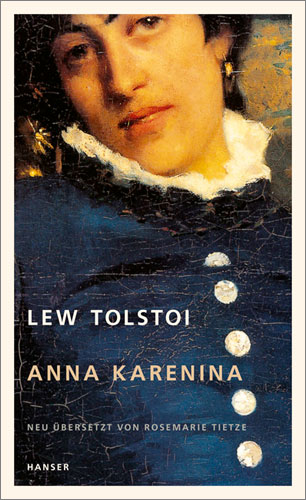Vorherrschend jedoch blieb an diesem Ort und in dieser Stunde die Freiheit; es war die Freiheit, was ihm am stärksten seine eigene, vor langer Zeit versäumte Jugend zurückbrachte.
 Auch der Hanser Verlag liefert in seiner Klassiker-Reihe einen Beitrag zum bevorstehenden Henry-James-Jubiläumsjahr: James’ später Roman „The Ambassadors“ (1903) erscheint in einer Neuübersetzung von Michael Walter, einem der renommiertesten deutschen Übersetzer. „Die Gesandten“ gelten einerseits als eines der späten Meisterwerke James’, sie stellen andererseits hohe Ansprüche an ihre Leser, heute wahrscheinlich mehr als noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts.
Auch der Hanser Verlag liefert in seiner Klassiker-Reihe einen Beitrag zum bevorstehenden Henry-James-Jubiläumsjahr: James’ später Roman „The Ambassadors“ (1903) erscheint in einer Neuübersetzung von Michael Walter, einem der renommiertesten deutschen Übersetzer. „Die Gesandten“ gelten einerseits als eines der späten Meisterwerke James’, sie stellen andererseits hohe Ansprüche an ihre Leser, heute wahrscheinlich mehr als noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts.
Die Handlung des Romans ist – wie oft bei Spätwerken anspruchsvoller Autoren – stark reduziert und bildet nicht mehr als ein Gerüst für das eigentliche Interesse des Erzählers: Erzählt wird ein knappes halbes Jahr aus dem Leben des US-Amerikaners Lewis Lambert Strether – wahrscheinlich benannt nach dem Titelhelden von Balzacs Roman „Louis Lambert“ (1845) –, der Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem kleinen und fiktiven amerikanischen Städtchen Woollett in der Nähe Bostons nach Paris reist. Strether, 55 Jahre alt und Witwer, ist im Auftrag seiner Chefin und Verlobten Mrs. Newsome unterwegs, um deren Sohn Chad in Paris loszueisen und nach Amerika zurückzubringen. Chad befindet sich inzwischen seit drei Jahren in Europa, und in Woollett vermutet man, dass er sich eine Beziehung zu einer moralisch fragwürdigen Frau zugezogen hat. In Woollett dagegen erwartet ihn nicht nur eine finanziell überaus lukrative leitende Position im väterlichen Unternehmen, sondern auch eine dieser Stellung angemessene Heirat mit der „fabelhaften“ – das für nahezu alle Personen ständig benutzte Epitheton Strethers – Mamie Pocock, mit deren Bruder Jim bereit Chads Schwester Sarah verheiratet ist.
In Paris zeigt sich Strether allerdings ein recht anderes Bild: Chad hat sich unter der leitenden Hand der verheirateten Comtesse Marie de Vionnet zu einem jungen Gentleman gemausert, der auf Strether einen gewaltigen Eindruck macht. Sein gehobener Umgang, seine vornehme Wohnung, seine Lebensart schlechthin überwältigen Strether so sehr, dass er bei ihrer ersten Begegnung zwar seinem Auftrag nachkommt, Chad zur Rückkehr aufzufordern, jedes ernsthafte Drängen in dieser Richtung aber unterlässt und anschließend seine Tage in Paris mehr oder weniger vorbeitreiben lässt. Er lernt die Comtesse und ihre ihn entzückende Tochter Jeanne kennen, befreundet sich mit John Bilham, einem von Chads US-amerikanischen Freunden und berichtet über all das brav und aufrichtig in Briefen nach Woollett. Als Chad sich dann endlich zur Abreise bereit erklärt, verhindert Strether dies in dem klaren Bewusstsein, dass Mrs. Newsome ihm weitere Gesandte nachschicken wird. Er lebt in der Überzeugung oder wenigstens der Hoffnung, dass auch diese Chads Verwandlung erkennen und seinen Verbleib in Europa befürworten werden. Um Strethers Haltung richtig einschätzen zu können, muss man noch wissen, dass er nahezu die einzige Figur des Romans ist, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten muss: Er ist Herausgeber einer von seiner Verlobten finanzierten Woolletter Zeitschrift, so dass er damit rechnen muss, nicht nur seine berufliche Stellung, sondern auch seine Alterssicherung zu verlieren, wenn er sich den Zorn der allmächtig im Hintergrund bleibenden Mrs. Newsome zuzieht.
Wie erwartet, tauchen nach einigen Wochen drei weitere Abgesandte in Paris auf: Chads Schwester mit Ehemann und Schwägerin. Entgegen Strethers Hoffnung ist Sarah von Chads Entwicklung nicht im geringsten beeindruckt, hält seine platonische Freundschaft mit der Comtesse schlicht für ein unmoralisches Verhältnis mit einer verheirateten Frau, die Comtesse selbst für eine adelige Schlampe und bringt überhaupt nur deshalb für einige Wochen Geduld mit Chad auf, weil sie selbst Urlaub in Paris zu machen gedenkt. Doch bevor sie mit ihrer Entourage zu einer kleinen Rundreise durch Europa aufbricht, setzt sie Chad und Strether die Daumenschrauben an. Und da sich Strether nicht vorbehaltlos auf ihre Seite schlägt, erklärt sie, nun „mit ihm fertig“ zu sein, wobei sie durchaus nicht nur für sich, sondern auch für ihre Mutter spricht. Bevor der Roman endet, steht Strether noch eine herbe Überraschung und Einsicht bevor, aber auch diese bewältigt er ganz und gar als der wahre Gentleman, der er ist. Das Ende des Romans bleibt mehr oder weniger offen: Ob Chad tatsächlich dauerhaft in Paris bei der Comtesse blieben wird und wie es in der privaten und beruflichen Zukunft Strethers, der vorerst einmal in die USA zurückkehrt, weitergehen wird, wird höchstens angedeutet.
Im Zentrum des Romans steht die Einsicht Strethers, sein Leben vertan zu haben. James selbst hat darauf hingewiesen, dass Strethers kleine Rede an den jungen Bilham über die „Illusion der Freiheit“ das eigentlichen Thema des Romans prägnant zusammenfasst:
Immerhin haben wir die Illusion der Freiheit; vergessen Sie deshalb nicht, so wie ich heute, diese Illusion. Ich war im entscheidenden Augenblick entweder zu dumm oder zu klug, mich daran zu erinnern; ich weiß nicht, was von beiden. Jetzt spricht aus mir die Reaktion auf diesen Fehler; und der Stimme der Reaktion sollte man fraglos nie ohne Vorbehalt begegnen. Das ändert aber nichts daran, dass für Sie jetzt die richtige Zeit da ist. Die richtige Zeit ist jede Zeit, die man zum Glück noch besitzt. […] Verpassen Sie bloß nichts aus Dummheit. […] Tun Sie, was Sie wollen, bloß begehen Sie nicht meinen Fehler. Denn es war ein Fehler. Leben Sie, leben Sie!
Dieses kleine Plädoyer für das Leben – das ursprünglich von James’ Freund und Mentor William Dean Howells stammt und die erste Idee zum Roman lieferte – beschreibt auf den Punkt, woraus sich Strethers Loyalität gegenüber Chad selbst dann noch speist, als er einsehen muss, von diesem belogen und manipuliert worden zu sein.
All dies wird in einem sehr langsamen und detaillierten Stil beschrieben. Die weitgehend personale Erzählperspektive des Romans und die damit einhergehende langsame und sozusagen schichtweise Einsicht in die bestehenden Sachverhalte sowie das Überwiegen dialogischer und reflektierender Passagen stellen einige Ansprüche an Geduld und Aufmerksamkeit der Leser. Der Roman unterläuft, wie Herausgeber Daniel Göske in seinem durchweg informativen Nachwort richtig anmerkt, alle damals gängigen Lesererwartungen an einen in Paris spielenden Roman: Er ist weder ein sozialkritischer Zeitroman, noch eine romantische Komödie, eine moralisierende Liebesgeschichte oder ein tragischer Ehebruchsroman. Auch für den Protagonisten eines Entwicklungsromans ist Strether deutlich zu alt. Auch der von James so ausgiebig bearbeitete Gegensatz Europa/USA spielt in diesem Fall nur eine untergeordnete, hintergründige Rolle. Für den Leser kommt es ganz und gar darauf an, sich auf die Person Strethers einlassen zu können; wer den sentimentalen Konflikt des Protagonisten nicht erfasst, für den ist der Roman verloren.
Die Neuübersetzung durch Michael Walter ist – bis auf winzige Kleinigkeiten – meisterlich. Walter versteht es, die komplexen Strukturen, in denen sich die Gedanken Strethers bewegen, im Deutschen perfekt nachzubauen. Die schwierigste Aufgabe bestand aber zweifelsohne darin, die nahezu immer nur indirekten und vieldeutigen Dialoge zwischen den Figuren wiederzugeben. Kaum jemals sagt in diesem Roman eine Figur unmittelbar, was sie meint; beinahe jede Äußerung enthält nicht nur eine Andeutung, sondern auch die Möglichkeit, sie misszuverstehen, und garantiert dem Sprecher zugleich die Möglichkeit der Ausflucht, nichts von alledem, was man verstehen könnte, tatsächlich gemeint zu haben. Das geht soweit, dass James eine der Nebenfiguren von der Bühne fliehen lässt, als sie sich in die Notlage versetzt sieht, Strether entweder geradewegs belügen oder gänzlich schweigen zu müssen. Dieses fragile System der Kommunikation, das schon im Original unendliche Mühe gemacht haben muss, ins Deutsche gerettet zu haben, ist kein kleines Meisterstück!
Ein Roman für Leser, die Zeit und Sorgfalt in seine Lektüre zu investieren bereit sind. Ich verspreche, dass sie dafür reicher belohnt werden als durch die Lektüre von zehn zeitgenössischen Krimis (von denen ich zugestandenermaßen keine Ahnung habe).
Henry James: Die Gesandten. Aus dem Englischen von Michael Walter. München: Hanser, 2015. Leinen, Fadenheftung, zwei Lesebändchen, 699 Seiten. 39,95 €.