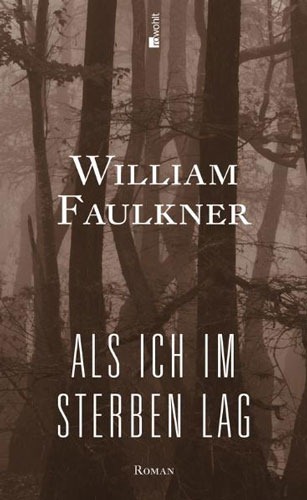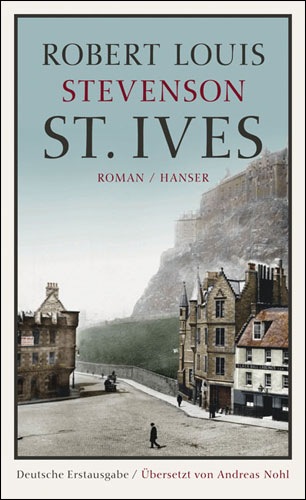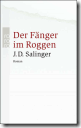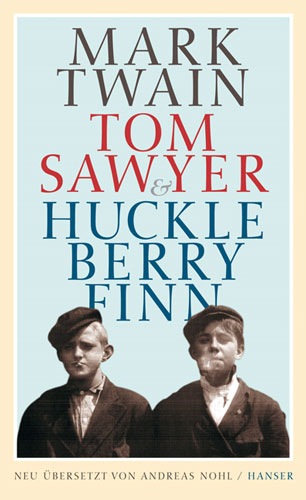Übersetzungen und Neuübersetzungen des Hanser Verlages kaufe ich normalerweise blind, da der Verlag allgemein für ein hohes Niveau und große Sorgfalt bei seinen Übersetzungen steht. Wenn dann auch noch eine feine Ausstattung des Bandes hinzukommt, freue ich mich ganz besonders auf die Lektüre. So auch diesmal: Zwei Klassiker der amerikanischen Literatur, bisher nicht gerade selten eingedeutscht, werden in einer Neuübersetzung vorgelegt, so wie es sich für Klassiker gehört: Leineneinband, feines Dünndruck-Papier und Fadenheftung – alles so, wie es sein soll. Da greife ich dann gern auch einmal tiefer in die Tasche.
Dann wird es Frühling, und an einem unerwartet sonnigen Tag greife ich mir den Band vom SUB (Stapel ungelesener Bücher) und nehme ihn mit ins Café. Als der Kaffee auf dem Tisch steht, schlage ich voller Vorfreude den »Huckleberry Finn« auf und beginne zu lesen. Aber schon nach wenigen Seiten stutze ich: Das kommt alles so betulich daher, und als die ersten Dialoge erscheinen, wundere ich mich doch sehr darüber, wie diese Mississippi-Kinder miteinander reden:
»So«, sagte Ben Rogers, »was ist denn die Geschäftssparte der Bande?«
»Nix, nur Raub und Mord«, sagte Tom.
»Aber wen rauben wir denn aus. Häuser … oder stehlen wir Vieh … oder …«
»Quatsch! Vieh stehlen und so was, das hat nix mit Räuberei zu tun, das ist Diebstahl«, sagte Tom Sawyer. »Wir sind keine Diebe. Das hat doch keinen Stil. Wir sind Wegelagerer. Wir halten Postkutschen und andere Kutschen auf der Straße an und haben Masken auf und töten die Leute und nehmen ihre Uhren und ihr Geld.«
»Müssen wir die Leute immer umbringen?«
»Ja, klar doch. Das ist das beste. Manche Fachleute denken da anders, aber die meisten halten es für das beste. Außer ein paar, die man in die Höhle hier bringt und gefangen hält, bis sie ausgelöst sind.«
»Ausgelöst? Was soll’n das sein?«
»Ich weiß nicht. Aber das wird so gemacht. Ich hab’s in Büchern gelesen. Und also müssen wir’s genauso machen.«
»Aber wie sollen wir’s machen, wenn wir nicht wissen, was es ist?«
»Das ist doch egal, wir müssen’s eben machen. Hab ich nicht gesagt, dass es in den Büchern steht? Wollt ihr es anders machen, als es in den Büchern steht und alles durcheinander bringen?«
»Das ist ja alles schön und gut, was du sagst, Tom Sawyer, aber wie zum Kuckuck sollen diese Leute ausgelöst werden, wenn wir nicht wissen, wie man das macht? Das möchte ich gerne mal wissen. Was glaubst du denn, was es ist?«
»Naja, ich weiß nicht. Aber vielleicht, wenn wir sie behalten, bis sie ausgelöst sind, dann heißt das, dass wir sie behalten, bis sie tot sind.«
»Na, das hört sich schon anders an. Das kommt hin. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wir behalten sie, bis sie zu Tode ausgelöst sind – aber es wird schon verdammt mühsam mit der Truppe, die werden uns die Haare vom Kopf essen und immer versuchen abzuhauen.«
»Wie du daherredest, Ben Rogers. Wie können sie abhauen, wenn eine Wache auf sie aufpasst und sie sofort abknallt, wenn sie einen falschen Schritt machen?«
»Eine Wache? Ja, das ist mal gut. Dann sitzt also jemand die ganze Nacht da, ohne zu schlafen, und passt auf sie auf. Das halte ich für den reinsten Blödsinn. Warum kann nicht jemand einen Knüppel nehmen und sie gleich auslösen, wenn sie ankommen?«
»Weil’s nicht so in den Büchern steht – deswegen. […]«
Stellen wir dem rasch mal die Original-Passage gegenüber:
»Now,« says Ben Rogers, »what’s the line of business of this Gang?«
»Nothing only robbery and murder,« Tom said.
»But who are we going to rob? houses – or cattle – or –«
»Stuff! stealing cattle and such things ain’t robbery, it’s burglary,« says Tom Sawyer. »We ain’t burglars. That ain’t no sort of style. We are highwaymen. We stop stages and carriages on the road, with masks on, and kill the people and take their watches and money.«
»Must we always kill the people?«
»Oh, certainly. It’s best. Some authorities think different, but mostly it’s considered best to kill them. Except some that you bring to the cave here and keep them till they’re ransomed.«
»Ransomed? What’s that?«
»I don’t know. But that’s what they do. I’ve seen it in books; and so of course that’s what we’ve got to do.«
»But how can we do it if we don’t know what it is?«
»Why blame it all, we’ve got to do it. Don’t I tell you it’s in the books? Do you want to go to doing different from what’s in the books, and get things all muddled up?«
»Oh, that’s all very fine to say, Tom Sawyer, but how in the nation are these fellows going to be ransomed if we don’t know how to do it to them? that’s the thing I want to get at. Now what do you reckon it is?«
»Well I don’t know. But per’aps if we keep them till they’re ransomed, it means that we keep them till they’re dead.«
»Now, that’s something like. That’ll answer. Why couldn’t you said that before? We’ll keep them till they’re ransomed to death – and a bothersome lot they’ll be, too, eating up everything and always trying to get loose.«
»How you talk, Ben Rogers. How can they get loose when there’s a guard over them, ready to shoot them down if they move a peg?«
»A guard. Well, that is good. So somebody’s got to set up all night and never get any sleep, just so as to watch them. I think that’s foolishness. Why can’t a body take a club and ransom them as soon as they get here?«
»Because it ain’t in the books so – that’s why. […]«
Wer ein Gespür für den Ton des Originals hat, bemerkt dass die neue Übersetzung den Dialog aufpoliert: Weder das »per’aps« noch das »reckon« des Originals sind angemessen übersetzt, überhaupt sind in der Übersetzungen die Verschleifungen reduziert und das sprachliche Niveau angehoben. Nicht, dass die Übersetzung falsch wäre, sie trifft nur den Ton des Originals nicht.
Doch ist das noch eine unproblematische Stelle. Jede Übersetzung des »Huck Finn« steht und fällt mit dem, was der Übersetzer aus der Sprache Jims macht:
I says:
»Hello, Jim!« and skipped out.
He bounced up and stared at me wild. Then he drops down on his knees, and puts his hands together and says:
»Doan’ hurt me – don’t! I hain’t ever done no harm to a ghos’. I awluz liked dead people, en done all I could for ’em. You go en git in de river agin, whah you b’longs, en doan’ do nuffn to Ole Jim, ’at ’uz awluz yo’ fren’.«
Well, I warn’t long making him understand I warn’t dead. I was ever so glad to see Jim. I warn’t lonesome, now. I told him I warn’t afraid of him telling the people where I was. I talked along, but he only set there and looked at me; never said nothing. Then I says:
»It’s good daylight. Le’s get breakfast. Make up your camp fire good.«
»What’s de use er makin’ up de camp fire to cook strawbries en sich truck? But you got a gun, hain’t you? Den we kin git sumfn better den strawbries.«
»Strawberries and such truck,« I says. »Is that what you live on?«
»I couldn’ git nuffn else,« he says.
»Why, how long you been on the island, Jim?«
»I come heah de night arter you’s killed.«
»What, all that time?«
»Yes-indeedy.«
Grundsätzlich sind hier drei Lösungswege versucht worden: Einige Übersetzer haben versucht, Jim einen bestimmten deutschen Dialekt reden zu lassen. Aber weder Bayerisch noch Sächsisch führen zu wirklich befriedigenden Ergebnissen. Andere Übersetzer haben versucht, einen Kunstdialekt zu erfinden, der den Ton von Jims Sprechweise im Deutschen nachzuahmen versucht. Wieder andere haben vor dem Problem kapituliert und ersetzen den starken Dialekt Jims durch einige wenige Verschleifungen. Diesen Weg geht auch die Neuübersetzung:
Dann sagte ich:
»Hallo, Jim!« und hüpfte hinter dem Busch hervor.
Er schrak hoch und starrte mich wild an. Dann fiel er auf die Knie und presste die Hände zusammen und sagte:
»Tu mir nix – bloß nix! Ich hab noch nie nem Gespenst was getan. Ich hab Tote immer gern gehabt und alles für sie getan, was ich konnte. Du gehst jetzt wieder innen Fluss zurück, wo du hingehörst, und tust dem alten Jim nix, der immer dein Freund gewesen is.«
Na, ich machte ihm schnell klar, dass ich nicht tot war. Ich war so froh, Jim zu sehen. Jetzt war ich nicht mehr allein. Ich sagte ihm, ich hätte keine Angst, dass er den Leuten verrät, wo ich war. Ich redete einfach drauflos, und er saß nur da und starrte mich an, sagte aber kein Sterbenswort. Dann sagte ich:
»Es ist schon richtig hell. Lass uns frühstücken. Mach dein Lagerfeuer ruhig wieder an.«
»Was hat’n das für ’n Sinn, das Lagerfeuer anzumachen, um Erdbeern und so ’n Grünzeug zu kochen. Aber du hast ja ’n Gewehr! Da können wir was Besseres wie Erdbeern holen.«
»Erdbeeren und so ’n Grünzeug«, sagte ich. »Was andres zum essen hast du nicht?«
»Ich hab sonst nix gefunden«, sagte er.
»Wieso, wie lang bist du denn schon auf der Insel, Jim?«
»Ich bin hier in der Nacht her, nachdem sie dich ermordet haben.«
»Was, die ganze Zeit?«
»Ja, so isses.«
Das ist natürlich im Vergleich zum Original gar nichts. Nun ist es aber so, dass die Verwendung der Dialekte im »Huck Finn« programmatisch ist. Der Verfasser stellt seinem Text ausdrücklich dies voran:
Explanatory
In this book a number of dialects are used, to wit: the Missouri negro dialect; the extremest form of the backwoods South-Western dialect; the ordinary ›Pike- County‹ dialect; and four modified varieties of this last. The shadings have not been done in a hap-hazard fashion, or by guess-work; but pains-takingly, and with the trustworthy guidance and support of personal familiarity with these several forms of speech.
I make this explanation for the reason that without it many readers would suppose that all these characters were trying to talk alike and not succeeding.
THE AUTHOR.
Mark Twain scheint also davon ausgegangen zu sein, dass die sprachliche Vielfalt seines Textes zum Vergnügen seiner Leser beitragen wird. Und er betont, dass er die Ausdifferenzierung unter Mühen erarbeitet hat, um die Sprechweise seiner Figuren so genau wie möglich an die von ihm erlebte Sprachfülle anzunähern.
Natürlich weiß das auch der Übersetzer Andreas Nohl, denn er hat die entsprechende Passage des Buches mit übersetzt. Was also bringt ihn dazu, die sprachliche Färbung weiter Textpassagen einfach zu ignorieren und zu ein paar Verschleifungen zu verflachen? Es ist einmal mehr die »Lesbarkeit«, der dies angeblich geopfert wurde:
Grundsätzlich wurde darauf verzichtet, den Slang des Ich-Erzählers und der sprechenden Personen in einem künstlichen deutschen Slang oder in einem Dialekt abzubilden. Darin unterscheidet sich die neue Übersetzung grundlegend von den bisherigen Übersetzungen.
[…]
Bei Huckleberry Finn gibt es neben den älteren Jugendbuchbearbeitungen zwei neuere Übersetzungen, deren Lesbarkeit aber durch deutsche Dialekteinsprengsel bzw. einen deutschen Kunst-Slang stark beeinträchtigt ist.
Was glaubt denn wohl der Übersetzer, wie das Original in dieser Beziehung von Muttersprachlern wahrgenommen wird? Und was mag er wohl über deutsche Bücher denken, deren Hauptforce gerade darin liegt, einen Kunst-Slang (z. B. Herbert Rosendorfers »Briefe in die chinesische Vergangenheit«) oder Dialekte und Sprechweisen (z. B. Arno Schmidts »Kaff auch Mare Crisium«) abzubilden. Wünscht er auch diese Bücher ins »Lesbare« übersetzt? Und was glaubt er wohl, warum sich ein deutscher Leser eine Übersetzung des »Huck Finn« kauft – um Mark Twain zu lesen oder Andreas Nohl?
Nun können sich deutsche Leser zum Glück entscheiden: Entweder sie folgen Andreas Nohl ins Land der sprachlichen Plattitüde, oder sie greifen zur Übersetzung von Friedhelm Rathjen und haben zusammen mit ihm und Mark Twain Spaß an der Sprache. Ich jedenfalls habe die Neuübersetzung bedauernd beiseite gelegt – so ein schönes Buch und so eine vertane Liebesmüh.
Mark Twain: Tom Sawyer & Huckleberry Finn. Herausgegeben und übersetzt von Andreas Nohl. München: Hanser, 2010. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, Dünndruck, 711 Seiten. 34,90 €.