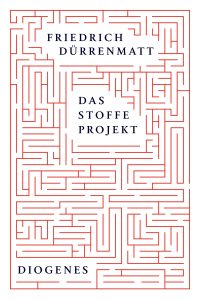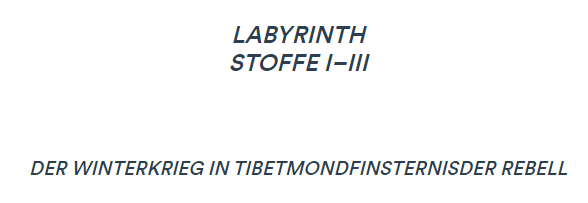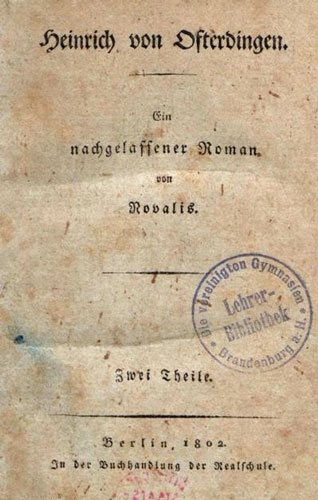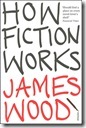Ich machte eine gut bürgerliche Jugend wie eine Krankheit durch, ohne Kenntnis der Gesellschaft und ihrer Zusammenhänge, behütet, ohne behütet zu sein, immer wieder gegen einen Zustand anrennend, der nicht zu ändern war: Ich selbst war dieser Zustand.
Wie bereits zuvor gesagt, umfassen die Bände I und II die Materialien aus dem Nachlass Friedrich Dürrenmatts zum Stoffe-Projekt bis zu Veröffentlichung des Bands Stoffe I–III im Jahr 1981. Band II enthält den Text dieses Bandes (in der leicht überarbeiteten Fassung von 1990, die dem Wunsch des Autors nachkommt, Absätze im Text weitgehend zu vermeiden und so eher einen Textfluss zu erzeugen), Band I chronologisch das seit 1957 bis 1981 aufgelaufene Material des Projektes. Es ist für Einsteiger durchaus zu empfehlen, sich zuerst einmal mit der Lektüre von Band II einen Eindruck von Thematik und Ausrichtung des Gesamtprojektes zu machen und dann erst zum Material in Band I zurückzugehen.
Der 1981 erschienene Band enthält, wie der Titel schon sagt, drei von Dürrenmatts Stoffen, die ihn lange begleitet und dabei durchaus wesentliche Veränderungen erfahren haben. Der erste, Winterkrieg in Tibet, spiegelt Dürrenmatts Auseinandersetzung mit seinen Kriegs- (als Schweizer war er ein eher ferner Beobachter des Geschehens im Zweiten Weltkrieg) und Militärerfahrungen, dem Mythos vom Minotaurus, der auch in anderen Texten und insbesondere auch in Gemälden von ihm eine bedeutende Rolle spielt, und damit unmittelbar zusammenhängend dem Motiv des Labyrinths. Erzählt wird die Geschichte eines Offiziers, der sich in der letzten gigantischen Schlacht des III. Weltkriegs wähnt, der weite Teile der Welt zerstört hat. Er sitzt als General ohne Truppen im Rollstuhl, durchfährt die Höhlengänge unter einem Bergmassiv und schreibt den Text, den der Leser liest, in absoluter Dunkelheit in langen Zeilen an die Höhlenwände. Durchbrochen wird dieser quasi autobiographische Bericht durch eine Art von Herausgeberfiktion, die die Wiedergabe des Textes als Dokumentation eines Fundes der nach dem III. Weltkrieg wieder erstandenen Zivilisation ausweist. Der Text enthält nicht nur die Geschichte und Vorgeschichte des Generals, sondern auch umfangreiche essayistische Passagen, deren Gehalt durch die Figur ihres Erzählers stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Entscheidend für die Lektüre dürfte der Hinweis Dürrenmatts sein, dass die zentrale Figur des Textes nicht Minotaurus repräsentiert, sondern einen Theseus, der seinen Ariadnefaden längst verloren hat und nicht in der Lage ist, einen eigenen zu knüpfen. Die Erzählung dürfte eine der dichtesten sein, die sich in Dürrenmatts erzählerischem Werk findet, und setzt einem einfachen Verständnis massive Widerstände entgegen.
Der zweiten Stoff, Mondfinsternis, ist die Quelle von Dürrenmatts wohl erfolgreichstem Theaterstück Der Besuch der alten Dame. In einem entlegenen Bergdorf der Schweiz, in dem außer Pfarrer, Polizist und Lehrerin nur 14 Familien leben, kommt ein alter, reicher Kanadier an, der nahezu sofort beginnt, alle jungen Frauen des Dorfes intensiv zu begatten. Außerdem verspricht er jedem Haushalt im Dorf eine Million, wenn beim nächsten Vollmond (in zehn Tagen) der Ehemann seiner ehemaligen Geliebten, die der Alte einstmals schwanger zurückgelassen hat, umgebracht wird. Der Betroffene ist angesichts des Reichtums auch für seine Familie durchaus mit dem Plan einverstanden und endet, nach einigem retardierenden Füllstoff, unter einer gefällten Buche. Es erweist sich aber, dass der Verursacher dieser Affäre eigentlich gar nicht an Tod und Rache interessiert ist (ebenso wenig wie an dem Geld, das er zurücklässt), sondern sich in Angst und Not wegen seines Herzens befindet. Als er das Dorf verlässt, erleidet er einen weiteren, diesmal tödlichen Herzanfall.
Der Text ist ohne jegliche Psychologie geschrieben: Eine Entwicklung der Figuren findet nicht statt, die für eine moderne Erzählung eigentlich fatale Wartezeit von zehn Tagen bis zum Vollmond-Termin wird einfach übersprungen, die titelgebende Mondfinsternis findet zwar statt, hat aber trotz der kurzzeitigen abergläubischen Panik der Bauern keinerlei praktische Auswirkung. Interessant ist aber, dass Dürrenmatt weder in der Erzählung selbst, noch in den reflektierenden Texten, die sie umgeben, auf das Motiv des Menschenopfers zu sprechen kommt. Nichts scheint einleuchtender, als den Ankommenden als einen neuen Gott zu lesen, der allgemeine Wohlfahrt verspricht, wenn man nur bereit ist, ihm einen Menschen als Opfer darzubringen. Und nichts ist einleuchtender, als dass ein Gott an nichts weniger interessiert sein kann als daran, ob die Menschen das Opfer tatsächlich vollziehen. Dass Dürrenmatt an diesem Aspekt seines Stoffes weitgehend uninteressiert gewesen zu sein scheint, mag daran liegen, dass in den beiden mythologischen Systemen, die sein Denken geprägt haben (das der griechischen Antike und das des Christentums). Menschenopfer nur eine randständige Rolle spielen.
Der dritte Stoff, Der Rebell, ist der am wenigsten ausgearbeitete; es handelt sich mehr um eine Prosa-Skizze als um eine Erzählung. Erzählt wird in wenigstens zu Anfang spätromantischer Manier vom Sohn eines Philologen, der in den Aufzeichnungen seines verschollenen Vaters eine altertümliche Sprache entdeckt, die er erlernt, um sich dann auf eine ziellose Reise zu machen, die ihn natürlich an die Grenze jenes Landes bringt, deren fremde Sprache er erlernt hat. Dort wird er als eine Art Messias empfangen, als der Retter und Befreier, der die Tyrannis des zuletzt erschienen Befreiers (der möglicherweise sein Vater ist) zerschlagen und wahrscheinlich durch seine eigene ersetzen wird. Warum Dürrenmatt dachte, diese Messias-Allegorie sei geeignet, seine eigene Rebellion gegen die Eltern darzustellen, die eigentlich nur in einem heimlichen und drückebergerischen Ungehorsam bestand, wie ihn jeder zweite junge Mann in der Weltliteratur zustande bringt, ist wenigstens mir unerfindlich geblieben.
Umschlossen sind diese drei Erzählungen von einer Autobiographie, die jeweils passend zu den Erzählungen gewichtet und reflektiert wird. Eine solche offene und zugleich enge Verquickung von autobiographischer und literarischer Erinnerungsarbeit dürfte in der deutschsprachigen Literatur weitgehend singulär sein. Die Materialien in Band I vertiefen diese beiden Aspekte der Stoffe, wobei das Material nicht nur die Stoffe I–III umfasst, sondern natürlich auch auf den späteren Band ausgreift. Hier ist besonders die Wiedergabe der Rekonstruktionen hervorzuheben, eines geschlossenen Textes von 1978, der so bislang unveröffentlicht war und der Dürrenmatt als Steinbruch für spätere Veröffentlichungen diente. Hier ist noch einmal ein Text zu entdecken, der es an Gehalt und Komplexität mit den beiden Nachworten zum Mitmacher-Komplex aufnehmen kann.
Bereits diese beiden Bände enthalten eine kaum auszuschöpfende Quelle für eine Auseinandersetzung mit Dürrenmatt, die mir aber leider, je älter ich werde und je weiter die Texte in der Vergangenheit liegen, um so mehr eine obsolete Angelegenheit zu werden scheint. Es ist zu befürchten, dass Dürrenmatt den Status eines Klassikers, den man ihm offenbar zuzumuten gedenkt, nicht lange innehaben wird. Dafür scheinen einerseits die Voraussetzungen für eine Lektüre zu hoch, andererseits ist der Anschluss zu den Themen der Gegenwart zu dünn. Ich fürchte, er wird trotz seines Reichtums an Reflexion und Erfindung bald nur noch ein Autor für einige wenige Fachleute sein.
Wird fortgesetzt …
Friedrich Dürrenmatt: Das Stoffe-Projekt. Hg. v. Ulrich Weber u. Rudolf Probst. Zürich: Diogenes, 2021. 5 Bände, Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 2208 Seiten. 400,– €.