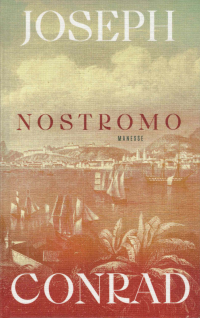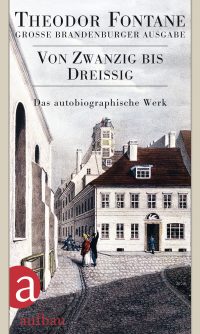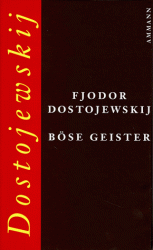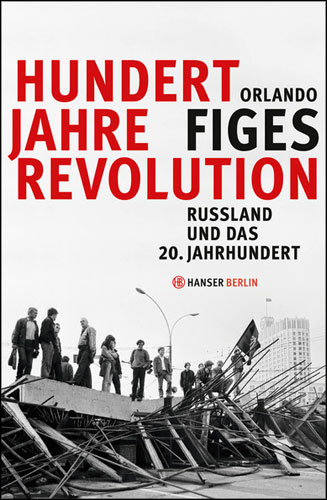Jedem sein eigenes Schicksal, geformt von Leidenschaft und Empfindung.
Zum 100. Todestag Joseph Conrads legt Manesse seinen Roman „Nostromo“ (1904) in einer neuen Übersetzung vor. Bereits Conrad selbst hatte das Gefühl, der Roman habe eine neue Epoche in seinem Erzählen eingeleitet, und viele Kritiker sind dieser Einschätzung gefolgt. Der Roman ist denn auch ungewöhnlich genug geraten und braucht eine ganze Weile, bis er in Fahrt kommt, nur um dann seine rattlin’ good story plötzlich wieder abzubrechen und zu einem mehr historisierenden Erzählen zurückzukehren.
Erzählt wird im Wesentlichen von den Ereignissen in und um Sulaco herum, einer fiktiven Hafenstadt im ebenso fiktiven südamerikanischen Staat Costaguana (was soviel wie Palmenküste heißen kann; allerdings hat guano auch noch eine andere Bedeutung). Costaguana zerfällt in eine Zentral- und eine Westprovinz, die durch einen hohen, unwegsamen Gebirgszug voneinander getrennt sind. Sulaco ist zu Zeiten der Segelschiffe aufgrund seiner sehr windstillen Bucht ein eher verschlafener Hafen von untergeordneter Bedeutung, bekommt aber durch die aufkommende Dampfschifffahrt und die erfolgreiche Wiedereröffnung einer lokalen Silbermine eine ganz neue Bedeutung. Die Lizenz zur Ausbeutung der Mine hat Charles Gould, der als Kind in Europa erzogen worden ist und dort auch studiert hat, von seinem englischstämmigen costaguanischen Vater geerbt, und die Mine zu einem Erfolg zu machen, ist ihm ein wenig zur fixen Idee geworden.
Doch Costaguana ist politisch instabil, und die in der Zentralprovinz ansässige rechtsliberale, republikanische Regierung, die selbst durch den Umsturz einer Tyrannei an die Macht gekommen ist, wird wiederum vom Militär gestürzt. In der Westprovinz bricht bei den Landbesitzern und Charles Gould eine milde Panik aus. Zwar schickt man eine zusammengewürfelte Armee aus, um sich der Bedrohung entgegenzustellen, aber die revolutionären Truppen halten sich nicht an den Plan der Verteidiger, sondern steuern über See und Berge Sulaco und seinen vermeintlichen Schatz an Silber direkt an. Diesen hat man allerdings kurz vor Ankunft der feindlichen Truppen auf einen Leichter verladen und in stockfinsterer Nacht hinaus in die Bucht geschickt, auf dass er in einen Nachbarstaat gerettet und von dort aus zur Finanzierung der Konterrevolution, vielleicht sogar zum Erringen der staatlichen Unabhängigkeit der Westprovinz dienen möge.
Erst mit diesem Rettungsversuch des Schatzes bekommt nach ca. 240 von 520 Seiten der Titelheld Nostromo endlich seine entscheidende Rolle zugeschrieben. Es handelt sich um einen genuesischen Seemann namens Giovanni Battista Fidanza, der in Sulaco gestrandet ist. Dort ist er aufgrund seines großspurigen und freigiebigen Auftretens und auch wegen seines Erfolgs bei Frauen zu einer Art Volksheld geworden (bei seinem ersten größeren Auftritt gestaltet Conrad ihn als einen Operetten-Don-Juan), der allgemein nur unter seinem Spitznamen Nostromo (einem verschliffenen nostro uomo) bekannt ist. Nostromo, der alles kann und alles wagt, ist der rechte Mann um den Silberschatz in der Nacht herauszuschmuggeln; er hat außerdem noch Martín Decoup an Bord, einen Journalisten und politischen Schwärmer, dem von den heranziehenden Truppen sicher der Tod droht, und einen Blinden Passagier, der an sich nicht weiter von Bedeutung ist, aber noch eine entscheidende Nebenrolle zu spielen hat.
Es ist nicht nötig, die eigentliche Handlung zu referieren und so den Erstlesern die Spannung zu rauben. Wichtig ist nur, dass der Abenteuerroman Episode bleibt. Vorangegangen ist eine gründliche Historie der jüngsten Vergangenheit Costaguanas sowie eine ausführliche Schilderung der Hauptcharaktere und ihrer Vorgeschichten (mit Ausnahme Nostromos, der, wie schon gesagt, in der ersten Hälfte des Buches beinahe nur als Randfigur vorkommt). Dabei ist diese erste Hälfte in einer mäandernden Erzählweise verfasst, die sich von Figur zu Figur hangelt und dabei weder Rücksicht auf eine strenge Chronologie, noch auf Vollständigkeit zu nehmen scheint. Trotzdem entwickelt sich mit der Zeit ein reiches und komplexes Bild Sulacos und seines politischen und gesellschaftlichen Umfeldes. Wie ebenfalls bereits gesagt, endet das Buch ähnlich historisierend wie es anfängt, wenn auch mit einer dramatischen, kaum vorhersehbaren Schlusspointe.
Alles in allem ein außergewöhnlicher Roman, der zwischen Fiktion und alternativer Geschichte, wie man das heute wohl nennt, seinen Weg sucht; ein geadelter Räuberroman, wenn man so will. Die Neuübersetzung ist angenehm zu lesen; an keiner Stelle merkt man ihr an, dass sie von zwei Übersetzern erstellt wurde. Auch haben sich Verlag und Übersetzer nicht dem herrschenden Zeitgeist gebeugt und heute politisch inkorrekte Ausdrücke, die Conrad wie selbstverständlich verwendete, abgeschwächt oder gar überschrieben. Auch sind die den Text durchsetzenden spanischen Wörter stehen geblieben (ein kleines Glossar am Ende hilft jenen, denen das Spanische fremd ist). Einzig, dass man den Untertitel “A Tale of the Seaboard” hat entfallen lassen, hat mich ein wenig irritiert.
Ein durchweg gelungenes Memento zur Feier Conrads!
Joseph Conrad: Nostromo. Aus dem Englischen von Julian und Gisbert Haefs. Zürich: Manesse, 2024. Bedruckter Leinenband, Fadenheftung, Lesebändchen, 536 Seiten. 38,– €.