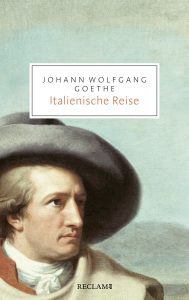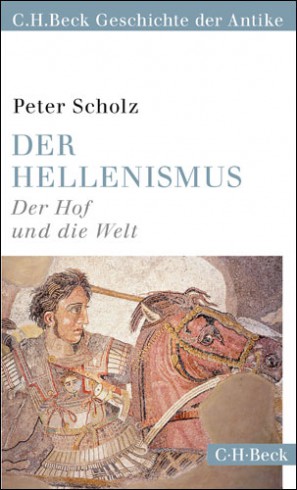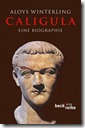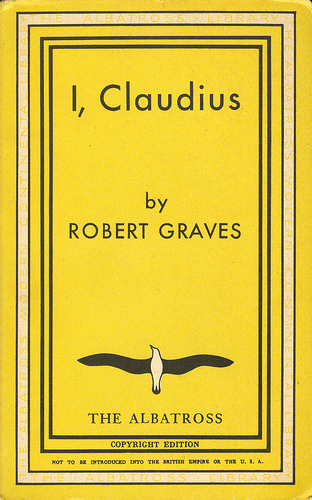Ja, ich kann sagen, dass ich die höchste Zufriedenheit meines Lebens in diesen letzten acht Wochen genossen habe und nun wenigstens einen äußersten Punkt kenne, nach welchem ich das Thermometer meiner Existenz künftig abmessen kann.
Nach zehn Jahren in Weimarischen Diensten schleicht sich der Minister Dr. von Goethe am 3. September 1786 von Karlsbad aus fort und reist endlich dorthin, wohin er schon 1775, vor seinem kurzen Abstecher nach Weimar, unterwegs gewesen war: nach Italien. Dies sollte sich als wichtigste Epoche seines Lebens erweisen, als die Zeit, in der er sich endgültig für ein Leben als Schriftsteller und Künstler entschied. Seine Rückkehr nach Weimar war – aus emotionalen wie aus ökomischen Gründen – unausweichlich, doch hatte er in Rom die Form der Existenz gefunden, die seinen Talenten und seine Bedürfnissen angemessen war.
Täglich wird mir’s deutlicher, dass ich eigentlich zur Dichtkunst geboren bin, und dass ich die nächsten zehen Jahre, die ich höchstens noch arbeiten darf, dieses Talent exkolieren und noch etwas Gutes machen sollte, da mir das Feuer der Jugend manches ohne großes Studium gelingen ließ.
In Rom erst ist Goethe zu dem Goethe geworden, der in den nächsten zumindest 100 Jahren zu einer kultischen Figur der deutschen Kultur werden sollte. Er konnte von Glück sagen, dass der Weimarer Herzog Karl August ihm in echter Freundschaft verbunden war und die Verschiebung des Lebensschwerpunktes Goethes vom Staatsbeamten zum Künstler nicht nur akzeptiert, sondern in den folgenden Monaten und Jahren auch tatkräftig ermöglicht hat.
Die Italienische Reise ist von Goethe als der zweite Teil seiner Autobiographie begriffen und gearbeitet worden. Der vorliegende Text stellte eine – durchaus uneinheitliche – Bearbeitung von Tagebüchern, Briefen und anderen Texten dar, die während der Reise entstanden waren. Nachdem er im Sommer 1813 die Arbeit an Dichtung und Wahrheit vorläufig abgebrochen hatte (der dritte Band erschien 1814, der vierte erst 1833 postum), wendet er sich dem Material zu, das seine erste Reise nach Italien dokumentiert. Es setzt nun – mit langen Unterbrechungen – über mehr als drei Jahre hinweg eine Auswahl und Überarbeitung dieser Aufzeichnungen und Briefe ein, die 1816 und 1817 zur Veröffentlichung der ersten beiden Bände führen. Erst 1829 wird Goethe dann den geplanten Abschlussband Zweiter Römischer Aufenthalt fertigstellen, der sich in Aufbau und Sprache deutlich von den beiden vorangegangen Teilen unterscheidet. Erst mit dem Erscheinen des dritten Bandes wählt Goethe für alle drei Teile den Titel Italienische Reise, wohl als Versuch, die innere Zusammengehörigkeit der sonst recht disparaten Texte zu betonen.
Ich bin im Dante-Jahr eher zufällig wieder einmal in die Italienische Reise hineingestolpert auf der Suche nach einer vage erinnerten Stelle, an der Goethe mit einem italienischen Dante-Enthusiasten aneinandergerät, der Nicht-Italienern schlicht jede Möglichkeit abspricht, die Commedia verstehen zu können. Die Lektüre von nur wenigen Seiten hat mir ein so überraschendes Vergnügen bereitet, dass ich das Buch zum ersten Mal komplett und in einem Zug gelesen habe. Besonders der erste Teil, der ganz nah am unmittelbaren Erleben geschrieben zu sein scheint, ist in einer so beweglichen und ansprechenden Prosa geschrieben, wie sie sich andernorts bei Goethe nur selten findet. Besonders meine letzten Lektüren seiner späteren Romane (Wahlverwandtschaften, Lehrjahre und Wanderjahre) hatten mich höchst unzufrieden mit der trockenen und weltarmen Prosa Goethes zurückgelassen. In der Italienischen Reise nun findet sich ein komplett anderer Ton und eine Welthaltigkeit, mit der ich bei ihm nicht mehr gerechnet hatte.
Natürlich fällt der späte, dritte Teil in dieser Hinsicht ab: Die Aufteilung des Textes in Wiedergabe von Korrespondenz und Bericht unter zusätzlicher Einschiebung essayistischer Teile (einer sogar aus der Feder von Karl Philipp Moritz), von denen der Leser nicht so ganz sicher ist, warum er das gerade hier lesen soll, macht den Text deutlich steifer und weniger lebendig; auch der Versuch der Einflechtung einer Liebesgeschichte hilft dem nicht auf.
Wer sehen will, was Goethe als Prosaautor konnte und vielleicht auch als Roman-Autor hätte können können (auf einen berechtigten Zuruf hin sei der Werther von diesem Urteil ausdrücklich ausgenommen), dem seien besonders die ersten beiden Teile der Italienischen Reise zur Lektüre anempfohlen. Eine – für mich wenigstens – überraschende Wiederentdeckung im Ozean der Goetheschen Schriften.
Johann Wolfgang Goethe: Italienische Reise. Kindle-Ausgabe. Stuttgart: Reclam, 2020. 605 Seiten (Druckausgabe). 9,99 €.