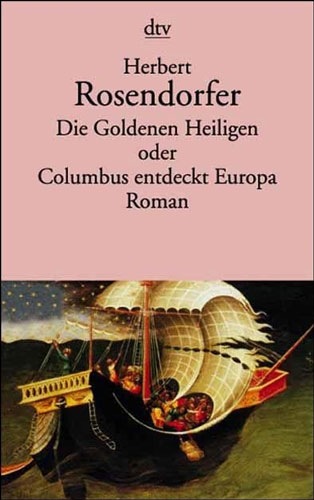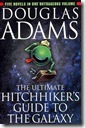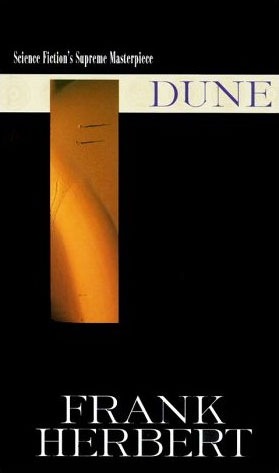Es schwebte ihm eine Lampe vor, die groß, aber gleichzeitig klein, schwarz lackiert, aber nicht dunkel, zart, aber doch stabil, hoch, aber doch eher niedrig wäre.
»Es ist immer angenehm«, sagte Jessica […], »einen Kunden zu haben, der seine eigene Meinung hat.«
Das Buch ist 1992 zum Anlass der (Wieder-)Entdeckung Amerikas vor 500 Jahren erschienen, worauf schon der Titel verweist. Ihm scheint kein sonderlicher Erfolg beschieden gewesen zu sein, da es im Gegensatz zu anderen Titeln Rosendorfs derzeit nicht lieferbar ist. Allerdings scheint man bei dtv eine Neuauflage zu planen.
Das Buch hat zwei deutlich unterschiedene Teile: Während der erste Teil in der Hauptsache eine Satire auf die esoterische Szene der 80-er Jahre enthält, schildert der zweite Teil das Aussterben der Menschheit innerhalb einer menschlichen Lebensspanne, nachdem Außerirdische zuerst in Europa, dann überall auf der Erde gelandet sind. Außer über die Erzählerfigur Menelik Hichter, der an dem Tag der ersten Landung der Außerirdischen geboren wird und das Buch als Erinnerungen des letzten Menschen niederschreibt, werden die beiden Teile in der Hauptsache dadurch verbunden, dass die Mutter Meneliks die Außerirdischen als Goldene Heilige begrüßt und von ihnen die Erlösung erwartet, was wesentlich dazu beiträgt, dass sich ein Widerstand der Menschheit gegen deren Okkupation erst herausbildet, als es bereits zu spät ist.
Doch der Reihe nach: Am 12. Oktober 1992, also genau 500 Jahre nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus (so ganz genau ist es natürlich nicht, da zwischen den beiden Daten die Umschaltung vom julianischen auf den gregorianischen Kalender stattgefunden hat; aber wir wollen nicht zu kleinlich sein) landet in der Nähe von Paderborn ein Raumschiff, das allerdings nach einigen Stunden wieder verschwindet, ohne dass ein First Contact stattgefunden hätte. Nur ein Schaf und ein paar zufällig auf der Landestelle hausende Alternative werden in Mitleidenschaft gezogen. Als die breitere Öffentlichkeit den Vorfall schon wieder vergessen hat, landen drei weitere Schiffe, denen wiederum nach beträchtlicher Zeit eine regelrechte Invasionsflotte folgt, die den Planeten systematisch unter Kontrolle bringt. Menschen, die versuchen, sich den Schiffen zu nähern, werden kurzerhand mit einer Strahlenwaffe eliminiert. Das einzige Interesse, dass die Außerirdischen vorerst zeigen, ist das für holländische Holzschuhe, an denen sie einen ebenso unerklärlichen wie gigantischen Bedarf zu haben scheinen.
Da die Besatzung der Erde durch Außerirdische mit den rasant eintretenden Folgen der Klimaveränderung zusammenfällt, gleitet die menschliche Zivilisation zuerst ins Chaos ab, um dann zu mittelalterlichen Zuständen zurückzukehren. Da dies die Produktion von Holzschuhen nicht wesentlich einschränkt – der einzige relevante Wirtschaftszweig, der noch für eine Weile Bestand hat –, stört es die Außerirdischen nicht weiter. Sorgen macht ihnen nur, dass ihnen offenbar eine weitere, feindlich gesinnte Gruppe von Außerirdischen Konkurrenz macht. Da zufällig Lärm als eine tödliche Überempfindlichkeit der Außerirdischen entdeckt wurde, wirbt die eine Gruppierung der Fremden menschliche Hilfstruppen an, die einen Lärmfeldzug gegen die andere führt. Nachdem die gegenseitigen Interessensphären geklärt sind und die Herstellung von Holzschuhen automatisiert worden ist, besteht keine weitere Notwendigkeit zur Erhaltung der Menschheit. Man verwendet sie noch als Jagdobjekt, treibt die Reste dann in einem Reservat zusammen, wo man sie gegen Eintritt zur Besichtigung freigibt. Als die Menschheit beinahe nur noch eine Erinnerung darstellt, entsteht sogar eine anthropologische Forschung der Außerirdischen, die schließlich auch die Niederschrift der Erinnerungen Meneliks veranlasst, aus denen das Buch besteht.
Die Parallelen zur Eroberung Amerikas durch die Europäer sind ebenso offensichtlich wie dick aufgetragen, wodurch die Erzählung in der Länge etwas zu vorhersehbar wird. Die Satire auf die Esoteriker scheint ein wenig aufgesetzt, ist aber erzählerisch notwendig, um die eher ereignislose Zeit des ersten Auftauchens der Außerirdischen anzureichern. Alles in allem schon ein witziges und gelungenes Buch, wenn Rosendorfer auch sicherlich besseres abgeliefert hat.
Herbert Rosendorfer: Die Goldenen Heiligen oder Columbus entdeckt Europa. München: Nymphenburger, 1992. Leinen, 277 Seiten. Derzeit nicht lieferbar.