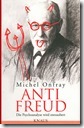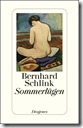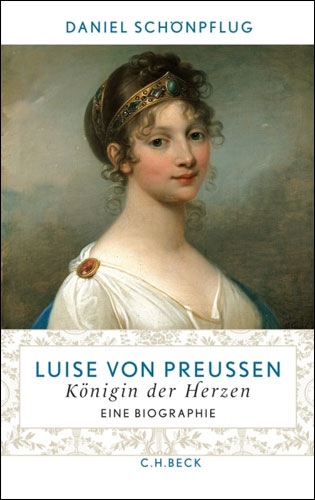Gerhard war ein lieber, kluger Kerl, aber sie brauchte einen Mann, der sie mit Stumpf und Stiel ausrottete.
 Beginnen wir mit dem Positiven: Natürlich ist es verdienstvoll, wenn eine der bekannteren jungen Autorinnen einen Roman einem der unbekannteren deutschen Philosophen widmet. Hans Blumenberg (1920–1996) ist eine wirkliche Berühmtheit als deutscher Philosoph, wie sie etwa Jürgen Habermas oder Hans Georg Gadamer erlangt haben (an Darsteller wie Peter Sloterdijk oder Rüdiger Safranski wollen wir hier gar nicht erst denken), erspart geblieben. Dazu war Hans Blumenbergs anthropologisches Denken wohl nicht recht geeignet, da sich aus seiner Position nur schlecht handfeste und eingängige gesellschaftliche Thesen ableiten ließen. Überhaupt behindert Blumenbergs tiefes Misstrauen gegen alle starken systematischen Zugriffe auf die Welt eine schlagwortartige Aufbereitung seines Denken, die ja in den meisten Fällen die Grundlage einer breiteren Popularisierung einer Philosophie bildet. Wer hat nicht schon alles vom Ding an sich, dem Weltgeist, der Dialektik der Aufklärung oder der Diskurs-Ethik geschwatzt, ohne auch nur eine Ahnung davon zu haben, worum es dabei eigentlich geht.
Beginnen wir mit dem Positiven: Natürlich ist es verdienstvoll, wenn eine der bekannteren jungen Autorinnen einen Roman einem der unbekannteren deutschen Philosophen widmet. Hans Blumenberg (1920–1996) ist eine wirkliche Berühmtheit als deutscher Philosoph, wie sie etwa Jürgen Habermas oder Hans Georg Gadamer erlangt haben (an Darsteller wie Peter Sloterdijk oder Rüdiger Safranski wollen wir hier gar nicht erst denken), erspart geblieben. Dazu war Hans Blumenbergs anthropologisches Denken wohl nicht recht geeignet, da sich aus seiner Position nur schlecht handfeste und eingängige gesellschaftliche Thesen ableiten ließen. Überhaupt behindert Blumenbergs tiefes Misstrauen gegen alle starken systematischen Zugriffe auf die Welt eine schlagwortartige Aufbereitung seines Denken, die ja in den meisten Fällen die Grundlage einer breiteren Popularisierung einer Philosophie bildet. Wer hat nicht schon alles vom Ding an sich, dem Weltgeist, der Dialektik der Aufklärung oder der Diskurs-Ethik geschwatzt, ohne auch nur eine Ahnung davon zu haben, worum es dabei eigentlich geht.
Auf der anderen Seite handelt es sich bei Hans Blumenberg zugleich um einen der zugänglichsten deutschsprachigen Philosophen des 20. Jahrhunderts, da man bei ihm eine sehr niedrige Einstiegsschwelle zum Werk findet: Blumenberg hat zahlreiche kurze Texte für Tageszeitungen verfasst, sehr oft Miniaturen, die wenig Vorwissen und nahezu keine philosophische Vorbildung voraussetzen. Der Suhrkamp Verlag hat eine reiche Auswahl dieser Texte in der Bibliothek Suhrkamp wieder abgedruckt, die eine beinahe unverbindliche Bekanntschaft mit diesem originellen Denker ermöglichen. (Ich werde hier zeitgleich mit dieser Besprechung eine des Bändchens »Löwen« veröffentlichen.)
Lewitscharoffs Erzählung beginnt im Jahr 1982, also nur wenige Jahre bevor Hans Blumenberg emeritiert. Zu Anfang entdeckt Blumenberg nächtens in seinem Arbeitszimmer einen Löwen, der sich allerdings nicht weiter um ihn kümmert. Auch am nächsten Tag erscheint der Löwe bei einer Vorlesung, doch scheint ihn außer Blumenberg keiner wahrzunehmen. Als Blumenberg eines Tages einen auf den Tod kranken Freund besucht und ihn der Löwe dabei begleitet, trifft er auf eine Nonne, die den Löwen ebenfalls sehen kann und mit Blumenberg einige lobende Worte über ihn wechselt. Später sieht Blumenberg den Löwen wieder in seinem Arbeitszimmer. Er wagt es aber nicht, mit einem befreundeten Journalisten über die Erscheinung des Löwen zu sprechen. Noch später stirbt Blumenberg.
Blumenberg hat naturgemäß auch Studenten. Isa ist in Blumenberg verliebt und sitzt bei allen seinen Vorlesungen in der ersten Reihe. Sie hat eine Liebelei mit Gerhard. Isa springt von einer Brücke vor einen Laster. Keiner versteht warum; auch der Leser nicht. Gerhard wird Philosophie-Professor und stirbt an einem Schlaganfall. Wenigstens da kann man sich für einen Moment lang einbilden, man verstehe warum. Richard ist Gerhards Freund und macht eine kleine Erbschaft, die es ihm erlaubt, in Südamerika ermordet zu werden. Hansi ist niemandes Freund und schreibt Gedichte, die sich reimen und die er in Gaststätten vorträgt. Er schnappt über und bricht, als man ihn abführt, tot zusammen. Nachdem alle tot sind, treffen sie sich in einer Höhle (vielleicht sogar der platonischen?) wieder und die Autorin raunt noch ein paar weitere Seiten zusammen, bevor das Buch dann endlich aus ist.
Ich gebe zu, dass meine Zusammenfassung etwas knapp geraten ist. Immerhin erfährt der nicht eingeschlafene Leser noch, dass das Ehepaar Blumenberg mit einem befreundeten Ehepaar und deren Mercedes in Ägypten war. Und dass Blumenberg gern Auto fährt. Wer aber hofft, auch nur Rudimentäres über Blumenbergs Philosophie zu erfahren oder mehr als zufällige Fragmente seiner Biographie, der wird sich enttäuscht finden. Am Ende weiß man fast mehr vom Löwen als über die Figuren, von Hans Blumenberg ganz zu schweigen.
Kollege Mangold vermutet, das Buch berge ein Geheimnis, das es nicht preisgebe. Ich vermute, die Autorin hat nicht so recht herausgefunden, was sie denn eigentlich erzählen will und sich ins Raunen gerettet; wenn sie es wenigstens noch in gutem Deutsch getan hätte. Ganz am Ende des Buchs bittet die Autorin um »Nachsicht«; verbuche ich die 21,90 € also unter Milde Gaben.
Sibylle Lewitscharoff: Blumenberg. Berlin: Suhrkamp, 2011. Bedruckter Pappband, 221 Seiten. 21,90 €.