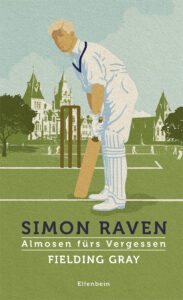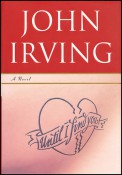»Ich glaube … dass es mir um Wahrheit geht.«
»Ist das nicht eine Nummer zu groß?«
»Nicht von allem. Nur im Kleinen, nur für mich. In einem kleinen Eckchen werde ich versuchen, Wahrheit zu schaffen.«
Ein weiterer englischer Schulroman, den mir mein Buchhändler nahegelegt hat, als wir über Eine Frage der Erziehung gesprochen haben. Auch Simon Raven, der überhaupt ein äußerst produktiver Autor gewesen ist, liefert gleich einen Romanzyklus – Alms for Oblivion / Almosen fürs Vergessen –, der zehn Bände mit zusammen etwa 2.300 Seiten und die Zeit zwischen 1945 und 1973 umfasst. Im Gegensatz zu A Dance to the Music of Time wurden die Romane nicht entlang der inneren Chronologie geschrieben, so dass der Beginn der Gesamthandlung erst in dem hier besprochenen, 1967 veröffentlichten vierten Band der Dekalogie gemacht wurde. Die deutsche Übersetzung des gesamten Zyklus soll bis 2024 erscheinen, wobei sich der Verlag insgesamt an die innere Chronologie des Zyklus hält (nur die Bände 2 und 3 bilden eine Ausnahme).
Die Haupthandlung beginnt im Mai 1945, nachdem der Zweite Weltkrieg in Europa zum Ende gekommen ist. Der Ich-Erzähler Fielding Gray, als Offizier der britischen Armee in Griechenland stationiert, blickt aus dem Jahr 1959 zurück auf das letzte Jahr seiner Schulzeit: Er ist der Musterschüler seines Jahrgangs, sowohl akademisch als auch als Sportler (in diesem Roman wird selbstverständlich Kricket gespielt) erfolgreich und bei seinen Mitschülern offenbar beliebt. Gray hat, wenn auch nicht ausschließlich, homoerotische Neigungen, und in diesem Jahr ist er sogar eindeutig verliebt in seinen Mitschüler Christopher Roland, der diese Neigung einerseits zu teilen scheint, andererseits aber dann doch erschrickt und schließlich gänzlich aus der Fassung gerät, als es ein einziges Mal zwischen den beiden zu einer kurzen sexuellen Berührung kommt.
Als Gray in den Ferien nach Hause fährt, muss er erfahren, dass sein Vater, der immer schon gegen Fieldings Plan war, nach der Schule Latein und Griechisch zu studieren, nun konkrete Vorbereitungen trifft, ihn von der Schule zu nehmen und in Indien auf einer Teeplantage in eine kaufmännische Ausbildung zu zwingen. Zwar stirbt der Vater ebenso spektakulär wie glücklich an einem Herzinfarkt, doch muss Gray feststellen, dass dies seine Situation wider Erwarten nicht verbessert. Während seine Mutter, solange der Vater am Leben war, ihn stets gegenüber dem Vater verteidigt hat, geht sie nun in das Lager des Feindes über und betreibt ebenfalls die Verhinderung von Fieldings akademischer Laufbahn.
Fielding erreicht eine Art von Kompromiss: Während er seiner Mutter vorgeblich nachgibt und seinen Militärdienst antritt, weil ihn seine Schule hinauswirft, da inzwischen gerüchteweise seine Affäre mit Christopher bekannt geworden ist, der sich zwischenzeitlich das Leben genommen hat. Daneben betreibt Gray weiterhin heimlich seine Studienpläne, da einer seiner Lehrer bereit ist, ihm das Studium zu finanzieren. So scheint für einen Moment alles gut auszugehen, bis wenige Tage nach dem Antritt der Grundausbildung Fielding von seinem Freund und Mitschüler Peter Morrison mitgeteilt wird, dass sich auch diese Aussicht zerschlagen hat, da der betreffende Lehrer von dem Streit zwischen Fielding und seiner Mutter und dem Versuch Fieldings, seine Mutter über seine wahren Pläne zu täuschen, moralisch so abgestoßen ist, dass er sein Angebot eines Stipendiums nicht weiter aufrecht hält. So entscheidet sich Gray für eine Karriere als Berufssoldat; eine letzte Begegnung mit Peter Morrison, den er 14 Jahre nicht gesehen hat und der inzwischen Berufspolitiker geworden ist, beendet das Buch und schließt den Rahmen der Erzählung.
Das Buch hat einen deutlich humoristischen Einschlag; sein Protagonist und Erzähler erweist sich immer erneut als im Sinne einer christlichen Moral indifferent, ja weitgehend gefühllos. Weder der Tod seines Vaters noch der Christophers gehen ihm nahe, er schlägt in Wut seiner Mutter ins Gesicht, ohne sich deshalb irgendwelche Vorwürfe zu machen, aber auch die Verhinderung seiner akademischen Karriere scheint ihn eher schulterzuckend zurückzulassen. Seinen Nachnamen ererbt er nicht umsonst von Oscar Wildes Dorian Gray, der auch noch, als sei es nicht auch ohne das deutlich genug, seine einzige moderne Lektüre darstellt. Wenn Fielding überhaupt einer Moral folgt, ist es die seiner Egozentrik; die wohl als Folie gedachte Antike, die sich in Grays Interesse für die antike Literatur widerspiegelt, hätte ihn für seine Indifferenz aber ebenso verurteilt wie seine Zeitgenossen.
Nicht alle Teile des Romans sind gleich gelungen; besonders die Dialoge sind eher schwach und erscheinen gekünstelt. Insbesondere dort, wo direkt über Moral gesprochen wird, sind sie flach und ermangeln der nötigen Reflexion. Aber das mag auch Absicht des Erzählers sein, um seine Verachtung für das moralisierende Geschwätz seiner Mitmenschen auszustellen.
Alles in allem ein Roman, der aus der Dutzendware des Jahrhunderts heraussticht, aber sicherlich nur auf seiner Position im Gesamtzyklus angemessen beurteilt werden kann.
Simon Raven: Fielding Gray. Aus dem Englischen übersetzt von Sabine Franke. Berlin: Elfenbein, 22020. Bedruckter Pappband, Fadenheftung, Lesebändchen, 262 Seiten. 22,– €.