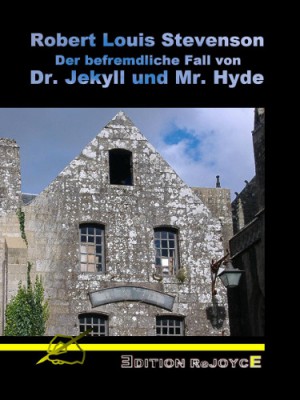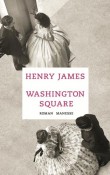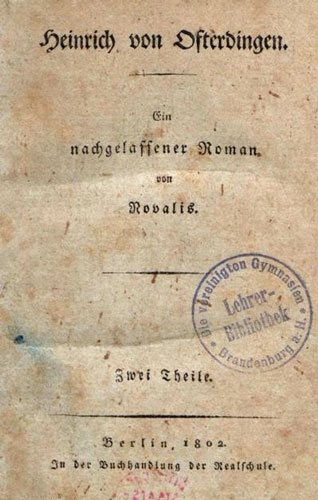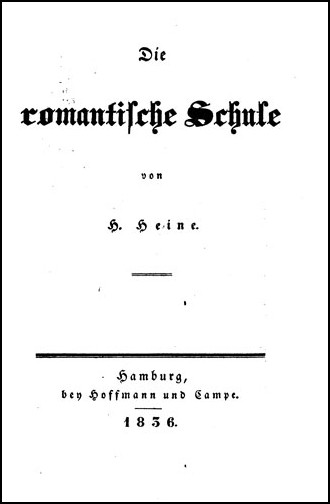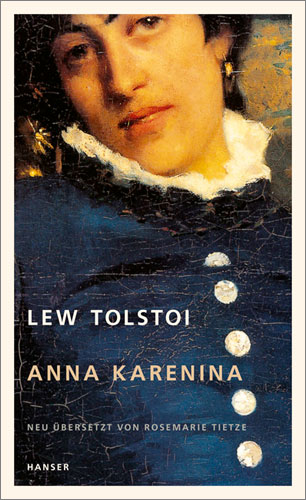Es handelt sich hier um eine jener Angelegenheiten, die sich durch Reden nicht reparieren lassen.
Die 1886 erschienene Erzählung von Dr. Jekyll und Mr. Hyde dürfte eines der erfolgreichsten Bücher Stevensons zu seinen Lebzeiten gewesen sein. Sie ist sowohl formal als auch inhaltlich der Romantik verpflichtet, und ihr simpler Dualismus von Gut und Böse dürfte in Verbindung mit der pseudowissenschaftlichen Grundierung wesentlich zu ihrem Erfolg beigetragen haben.
Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive eines distanzierten Beobachters, der Advokaten Utterson, der mit Dr. Henry Jekyll seit langem befreundet ist. Dr. Jekyll ist Mediziner und ein vorbildlicher Bürger Londons, der allerdings phasenweise zur Absonderung von seinen Freunden neigt. Er bewohnt ein großes Haus, das früher einem Anatom gehört hat; Jekyll gehört als Chemiker der wissenschaftlich nächsten Generation von Medizinern an; er hat den Seziersaal seines Vorgängers in ein Laboratorium verwandelt. Hier findet er eher zufällig eine Droge, die die böse Seite seiner Persönlichkeit an die Oberfläche bringt; im Zuge dieser Verwandlung stellt sich auch eine massive körperliche Veränderung ein: der hochgewachsene Dr. Jekyll wird zu dem kleingeratenen, häßlichen und von seinen Mitmenschen als verwachsen empfundenen Edward Hyde. Die Verwandlung lässt sich bequemerweise mit einer weiteren Gabe derselben Droge wieder rückgängig machen.
Von all dem erfährt der Leser aber nur Stück für Stück: Zuerst steht die merkwürdige Verbindung zwischen dem hoch angesehenen Dr. Jekyll und dem etwas merkwürdigen, moralisch fragwürdigen Mr. Hyde im Zentrum, den Jekyll in seinem Testament zu seinem Universalerben eingesetzt hat, selbst für den Fall, dass er nur für mehr als drei Monate verschwunden sein sollte. Die Lage spitzt sich zu, als Hyde einen Mord begeht, für den es einen Zeugen gibt und der ihn zwingt, anscheinend aus London zu verschwinden. Mit dem Verschwinden Hydes kehrt Jekyll für eine Weile zu seinen alten, geselligen Gepflogenheiten zurück, doch dann stellen sich plötzlich die alten Verhältnisse wieder ein.
Zur Krise kommt die Erzählung, als Utterson vom Hausdiener Jekylls aufgesucht wird, der über die seltsamsten Zustände im Haus seines Herrn berichtet: Der Doktor verlasse seinen Raum über dem Laboratorium kaum noch, keiner seiner Bediensteten habe ihn seit Tagen gesehen, der Butler vermutet sogar, dass es gar nicht Jekyll ist, der im Haus lebt. Eine Inspektion des Hauses führt auch Utterson zu der Überzeugung, dass es Hyde sein muss, der dort lebt. Als man sich schließlich entschließt, die Tür zu dem Wohnraum aufzubrechen, findet man dort Hyde vor, der sich mit Blausäure das Leben genommen hat. Aus einem von Jekyll hinterlassenen Dokument erfährt Utterson – und mit ihm der Leser – nun alles über den befremdlichen Fall: dass sich Jekyll immer häufiger spontan in Hyde verwandelt habe; dass diese böse Seite sich nur unter Maßgabe der Droge für immer kürzere Zeit habe unterdrücken lassen; dass die Droge zur Neige gegangen und in ihrer besonderen Zusammensetzung nicht wieder zu beschaffen gewesen und so Hyde letztlich zum stabilen Zustand der Persönlichkeit Jekylls geworden sei.
Das Hübsche an dieser im Grunde sehr einfach gestrickten Fabel ist, dass sie sich widerstandslos zahlreichen interpretatorischen Zugriffen öffnet: Man kann sie lesen als eine Allegorie auf die dualistische Natur des Menschen, als eine Variation auf die Geschichte von Kain und Abel, als Vorgriff auf die psychoanalytischen Konzepte von Über-Ich und Unbewusstem, als Geschichte eines dem Wahnsinns verfallenden Wissenschaftlers und zweifellos noch auf diverse andere Weisen. So schlicht die Erzählung ist, sie bildet einen eleganten Fokus für zahlreiche Themen der Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts, und sie funktioniert darüber hinaus auch noch als Horrorerzählung.
Die hier vorgestellte Ausgabe der Erzählung in der Übersetzung Friedhelm Rathjens ergänzt den bereits früher hier angezeigten Band „Stimmen“ im Selbstverlag des Übersetzers. Die Übersetzungen aus diesen beiden Büchern sind 1998 erstmals bei Haffmans erschienen und bildeten damals zusammen mit Rathjens Übersetzung der „Schatzinsel“ und einem dritten Band eine kleine Werkauswahl Stevensons. Mit „Der befremdliche Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ liegen nun erfreulicherweise alle diese Übersetzungen Rathjens wieder vor. Die Ausgabe ist auf 99 nummerierte und signierte Exemplare limitiert. Bestellungen erfolgen am besten per E-Mail direkt beim Verlag.
Robert Louis Stevenson: Der befremdliche Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Übersetzt von Friedhelm Rathjen. Südwesthörn: Ǝdition RejoycE, 2016. Bedruckter Pappband, 106 Seiten. 25,– €.