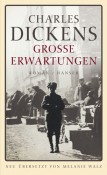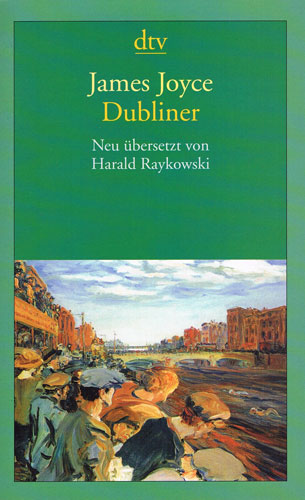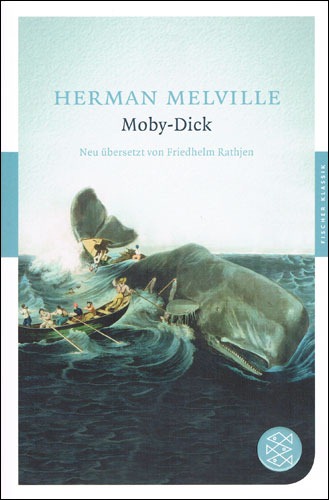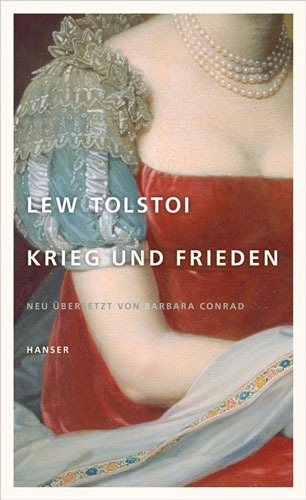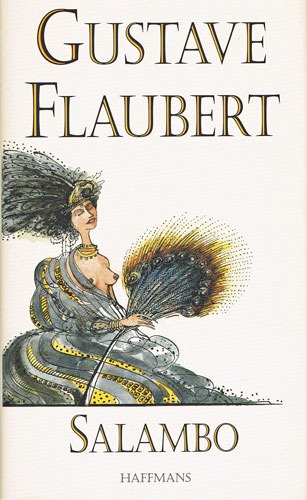Heute wäre es keinem von uns mehr möglich, sich auch nur im geringsten an ihn zu erinnern.
 In der verdienstvollen Reihe von Kassiker-Neuübersetzungen, die in schöner Folge und hervorragender Ausstattung bei Hanser erscheinen, ist im letzten Jahr auch Flauberts »Madame Bovary« einmal mehr vorgelegt worden. Die Übersetzerin Elisabeth Edl, die zu Recht mit Ihren Übersetzungen Stendhals bekannt geworden ist, legt nach ihrer eigenen Zählung immerhin schon die 28. Übersetzung des Textes ins Deutsche vor. Dabei geht sie mit den Vorläufern hart ins Gericht:
In der verdienstvollen Reihe von Kassiker-Neuübersetzungen, die in schöner Folge und hervorragender Ausstattung bei Hanser erscheinen, ist im letzten Jahr auch Flauberts »Madame Bovary« einmal mehr vorgelegt worden. Die Übersetzerin Elisabeth Edl, die zu Recht mit Ihren Übersetzungen Stendhals bekannt geworden ist, legt nach ihrer eigenen Zählung immerhin schon die 28. Übersetzung des Textes ins Deutsche vor. Dabei geht sie mit den Vorläufern hart ins Gericht:
Selbstverständlich finden sich unter diesen 27 Versionen auch solche, die den Roman flüssig und in geläufiger deutscher Sprache wiedergeben; es gibt allerdings auch erstaunlich viele Stellen, die allein sachlich noch niemals richtig übersetzt wurden. Aber auch die besten unter ihnen verfehlen die spezifische Qualität ganz und gar; gerade auch die berühmte und oft gelobte Übersetzung von René Schickele ist eher eine schöne, freie Nacherzählung als eine Übersetzung Flauberts.
Edl kritisiert die mangelnde Sorgfalt bei der Übersetzung von grammatikalischer Struktur und Wortstellung, die Flaubert in mühevollster Arbeit herauskristallisiert habe. Auch an der Wiedergabe der von Flaubert jeweils gewählten sprachlichen Stilebene würden alle bisherigen deutschen Ausgaben wesentlich scheitern. Am verzeihlichsten ist wohl, wenn Doppeldeutigkeiten und Wortspiele unübersetzt bleiben, da sich ein Übersetzer hier immer zwischen der Skylla der wörtlichen Übersetzung und der Charybdis der Ersetzung durch ein zielsprachliches Pendant durchlavieren muss, die sich in den meisten Fällen beide als nur mäßig witziger Ersatz für das Original erweisen.
Nun reicht mein fragmentarisches Französisch, das sich hauptsächlich aus meinem Latein speist, nicht hin, um die Übersetzung Edls daraufhin abzuklopfen, ob sie den theoretischen Ansprüchen der Übersetzerin tatsächlich genügt. Alles, was ich vermag, ist es, einige auffällig Stellen herauszupicken und mit dem Original und der zufälligen Auswahl von Übersetzungen zu vergleichen, die mir vorliegt.
Beginnen wir mit einer der offenbar hässlichen Stellen, an der eine anstößige Wiederholung ein und derselben Formulierung aufstößt:
Madame Bovary nahm die Schüssel. Um sie unter den Tisch zu stellen, bückte sie sich und machte eine Bewegung, bei der ihr Kleid (es war ein Sommerkleid mit vier Volants, gelb, lange Taille, weiter Rock), bei der ihr Kleid sich auf den Fliesen der Stube glockig um sie rundete; … (Edl, S. 173)
Schauen wir zuerst einmal, was die anderen Übersetzer schreiben:
- Frau Bovary nahm die Schüssel und stellte sie unter den Tisch; bei dieser Bewegung bauschte sich ihr Kleid (es war mit vier Volants besetzt, gelb, mit langer Taille und weit geschnittenem Rock), breitete sich rings um sie auf dem Fußboden aus. (René Schickele (1907), hier zitiert nach einer Ausgabe bei Manesse von 1952, S. 209 f.)
- Frau Bovary ergriff die Schüssel und setzte sie unter den Tisch. Bei diesem Bücken bauschte sich ihr Rock (ein weiter gelber Rock mit vier Falbeln) um sie herum und stand wie steif auf der Diele, … (Arthur Schurig (1911), hier zitiert nach einer Ausgabe im Insel Verlag von 1952, S. 161.)
- Madame Bovary nahm die Schüssel und wollte sie unter den Tisch stellen. Als sie sich bückte, breitete sich ihr Kleid – ein gelbes Sommerkleid mit vier Volants, langer Taille und weitem Rock – rings um sie auf den Fliesen aus. (Walter Widmer (1959), hier zitiert nach einer Ausgabe bei Artemis & Winkler von 1993, S. 170.)
- Madame Bovary nahm das Becken, um es unter den Tisch zu stellen. Als sie sich dabei hinunterbeugte, breitete sich ihr Kleid (es war ein Sommerkleid mit vier Volants, von gelber Farbe, mit langer Taille und weitgeschnittetem Rock) um sie herum auf den Fliesen des Wohnzimmers aus; … (Caroline Vollmann, Haffmans, 2001, S. 182.)
Wie man auf den ersten Blick sieht, findet sich in keiner der vorherigen Übersetzungen die Wiederholung der Phrase bei der ihr Kleid, so dass der Verdacht eines Übersetzungsfehler nahe liegt. Schauen wir also ins Original:
Madame Bovary prit la cuvette. Pour la mettre sous la table, dans le mouvement qu’elle fit en s’inclinant, sa robe (c’était une robe d’été à quatre volants, de couleur jaune, longue de taille, large de jupe), sa robe s’évasa autour d’elle sur les carreaux de la salle; …
Tatsächlich findet sich die stilistisch harte Wiederaufnahme des Satzes durch die Wiederholung des sa robe bei Flaubert, und Edls Übersetzung scheint die erste zu sein, die dieser Härte nicht ausweicht und versucht, dem Autor stilistisch aufzuhelfen, sondern sich an Struktur und Wortwahl des Originals hält.
Schauen wir eine andere Stelle an, bei der das Original der Übersetzung einigen Widerstand entgegensetzt: Der Apotheker Homais, eine der wichtigsten Nebenfiguren des Romans, wird mit einer seiner besserwisserischen Tiraden in den Roman eingeführt. Opfer seiner Belehrung ist die Wirtin des Lion d’or, die über die Notwendigkeit unterrichtet wird, sich einen neuen Billardtisch zuzulegen:
Puisque celui-là ne tient plus, madame Lefrançois, je vous le répète, vous vous faites tort! vous vous faites grand tort! Et puis les amateurs, à présent, veulent des blouses étroites et des queues lourdes. On ne joue plus la bille; tout est changé! Il faut marcher avec son siècle!
Hier ist die Bedeutung des kurzen Satzes On ne joue plus la bille durchaus nicht auf Anhieb klar. Dementsprechend unterschiedlich fallen die Übersetzungen aus:
- … man spielt jetzt eben anders! (Schickele, S. 125)
- Mit solchen Bällchen spielt man nicht mehr. (Schurig, S. 97)
- Man spielt nicht mehr so gemütlich mit Murmeln, … (Widmer, S. 101)
- … man spielt die Kugeln nicht mehr direkt; … (Vollmann, S. 109)
Während René Schickele nicht den Satz, sondern sein Unverständnis ins Deutsche übersetzt, reimen sich Schurig und Widmer (dieser auch noch unter Hinzufügung eines nicht im Original zu findenden Adjektivs) etwas zusammen, was der Satz durchaus bedeuten könnte, was er aber eben nicht eindeutig bedeutet. Caroline Vollmann versteht wenigstens die Funktion des Satzes, nämlich dass sich Homais hier mit einer fachmännisch klingenden Phrase gegenüber der Wirtin als Kenner ausweisen möchte, doch gerät ihre Lösung leider zu konkret und sinnvoll. Elisabeth Edl wählt dagegen eine Wendung, die ebenso undeutlich ist wie das Original: Man bespielt die Kugeln nicht mehr; (S. 103) – auch hier weiß der Leser nicht, was eigentlich mit dem Satz gemeint sein soll, denkt aber, besonders wenn er vom Billard so wenig versteht wie die Wirtin, es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.
Man verzeihe mir ein letztes, kurzes Beispiel: Auf S. 212 der hier besprochenen Übersetzung ragt das Wort Lassreidel aus dem Text heraus:
Sie kamen zu einer breiteren Stelle, wo man Lassreidel gefällt hatte. Sie setzten sich auf einen umgelegten Baumstamm und Rodolphe sprach nun von seiner Liebe.
Für das Wort Lassreidel findet sich im Original der Ausdruck baliveaux. Beides sind Fachwörter aus der Forstwirtschaft und bezeichnen Bäume eines sogenannten Mittelwalds, die bei einer Fällung vorerst stehen geblieben sind, um erst ein oder mehrere Jahre später gefällt zu werden. Das Wort Lassreidel auch nur zu finden, dürfte keine kleine Mühe gewesen sein. Schauen wir noch einmal, wie es die anderen machen:
- Sie kamen auf eine Lichtung. Sie setzten sich auf einen umgestürzten Baumstamm und Rodolphe begann von seiner Liebe zu sprechen. (Schickele, S. 258)
- Sie standen in einer Lichtung, in der gefällte Baumstämme lagen. Sie setzten sich beide auf einen.
Von neuem begann Rudolf, von seiner Liebe zu reden. (Schurig, S. 197)
- Sie gelangten auf eine kleine Lichtung, wo man junge Stämme gefällt hatte. Sie setzten sich auf einen der umgelegten Bäume, und Rodolphe fing an von seiner Liebe zu reden. (Widmer, S. 208)
- Sie kamen auf eine Lichtung, auf der Jungholz geschlagen worden war. Sie setzten sich auf einen gefällten Baumstamm, und Rodolphe begann, von seiner Liebe zu ihr zu sprechen. (Vollmann, S. 223)
Und zum Abgleichen das Original:
Ils arrivèrent à un endroit plus large, où l’on avait abattu des baliveaux. Ils s’assirent sur un tronc d’arbre renversé, et Rodolphe se mit à lui parler de son amour.
Gerade dieses Beispiel ist hübsch, weil keiner der oben zitierten Übersetzer der Falle entgangen ist, un endroit plus large mit Lichtung zu übersetzen. Flauberts Text aber weiß gar nichts von einer Lichtung, sondern nur von einem etwas weiteren Platz, auf dem einige wenige Bäume gefällt worden sind. Während sich Schickele und Schurig (dessen Sie setzten sich beide auf einen das Zeug hat, in der ewigen Bestenliste übersetzerischer Stilblüten einen der vorderen Plätze einzunehmen) um das Problem herumdrücken, baliveaux zu übersetzen, wählt Vollmann mit Jungholz wenigstens einen forstwirtschaftlich klingenden Begriff, nur leider handelt es sich eben gerade nicht um Jungholz, das da gefällt worden ist.
Natürlich ist eine solch zufällige Stichprobe nicht wirklich aussagekräftig, und es gibt Berufenere, ein Urteil über die Qualität dieser Neuübersetzung zu fällen, aber dort, wo ich sie geprüft habe, bewährt sich Edls Übersetzung als präzise und eng am Original geführt.
Abgesehen von der Frage nach der Qualität der Übersetzung, ist dies die erste vollständige deutsche Ausgabe des Romans in dem Sinne, dass sie dem Vorbild der letzten, von Flaubert selbst zum Druck beförderten französischen von 1873 folgt und im Anschluss an den Roman den Prozess von 1857 dokumentiert. Unmittelbar an den Text des Romans angehängt finden sich das Plädoyer des Staatsanwaltes, die Verteidigung von Flauberts Anwalt und der Freispruch des Gerichts, der Flaubert zu einem der erfolgreichsten Sensationsautoren der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte. Mit der kommentarlosen Wiedergabe dieser Dokumente zelebriert Flaubert natürlich seinen Sieg über die zeitgenössischen Spießer, die seinen Roman aus mehr als einem Grund gerne verboten gesehen hätten.
Zum Inhalt dieser Mutter aller modernen Romane etwas zu sagen oder gar zur Bedeutung des Buches, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Vielleicht nur soviel, dass dies wahrscheinlich meine zehnte Lektüre dieses Buches in mehr als dreißig Jahren war und ich den Roman immer noch als ein Wunderwerk anzustaunen vermag. Es ist ein Buch von erstaunlicher künstlerischer Integrität und von einer solch gelassenen erzählerischen Kühle, wie man sie nur sehr selten in der Literatur findet. Wenn die 29. Übersetzung erscheinen wird, werde ich es sicherlich wieder lesen.
Gustave Flaubert: Madame Bovary. Sitten in der Provinz. Übersetzt von Elisabeth Edl. München: Hanser, 2012. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 759 Seiten. 34,90 €.