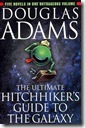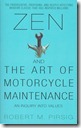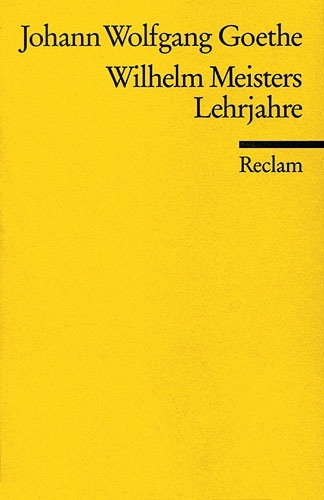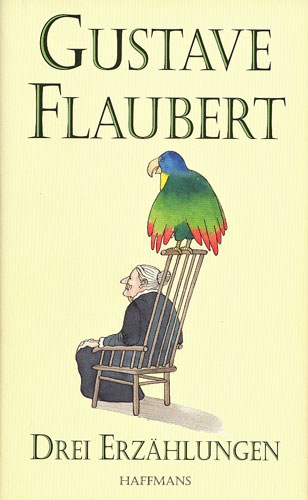»Siehst Du wohl,« sagte Hans Castorp später zu seinem Vetter, »siehst Du wohl, daß es in der Literatur auf die schönen Worte ankommt? Ich habe es gleich gemerkt.«
 Zuletzt habe ich den »Zauberberg« mit großer Begeisterung 1986 während des Studiums gelesen. Während ich zur gleichen Zeit den Glauben an Thomas Mann als bedeutendem deutschen Intellektuellen endgültig durch die Lektüre der »Betrachtungen eines Unpolitischen« verloren habe, hat dieser Roman die Überzeugung verfestigt, dass er einer der besten deutschsprachigen Erzähler war. In den Jahren dazwischen habe ich immer wieder einmal versucht, Mann zu lesen, bin aber damit nie recht fertig geworden: Im »Doktor Faustus« war mir bei der Zweitlektüre der Erzähler nur schwer erträglich, um »Lotte im Weimar« recht zu goutieren verstand ich wohl noch zu wenig von Goethe – da hat sich erst die dritte Lektüre als vergnüglich erwiesen –, der »Joseph« war eindeutig zu geschwätzig für den in weiten Teilen unerheblichen Stoff und an den »Zauberberg« wollte ich dann nicht noch einmal heran, aus Furcht, ihn mir zu verderben. Erst mit dem Erscheinen der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe stellte sich die Lust wieder ein, es erneut zu versuchen.
Zuletzt habe ich den »Zauberberg« mit großer Begeisterung 1986 während des Studiums gelesen. Während ich zur gleichen Zeit den Glauben an Thomas Mann als bedeutendem deutschen Intellektuellen endgültig durch die Lektüre der »Betrachtungen eines Unpolitischen« verloren habe, hat dieser Roman die Überzeugung verfestigt, dass er einer der besten deutschsprachigen Erzähler war. In den Jahren dazwischen habe ich immer wieder einmal versucht, Mann zu lesen, bin aber damit nie recht fertig geworden: Im »Doktor Faustus« war mir bei der Zweitlektüre der Erzähler nur schwer erträglich, um »Lotte im Weimar« recht zu goutieren verstand ich wohl noch zu wenig von Goethe – da hat sich erst die dritte Lektüre als vergnüglich erwiesen –, der »Joseph« war eindeutig zu geschwätzig für den in weiten Teilen unerheblichen Stoff und an den »Zauberberg« wollte ich dann nicht noch einmal heran, aus Furcht, ihn mir zu verderben. Erst mit dem Erscheinen der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe stellte sich die Lust wieder ein, es erneut zu versuchen.
Erzählt wird bekanntlich die Geschichte des jungen Hamburger Ingenieurs Hans Castorp, der auf drei Wochen nach Davos reist, um seinen kranken Vetter Joachim Ziemßen zu besuchen. Im internationalen Kurhotel Berghof angekommen, verliebt er sich in eine wenige Jahre ältere Russin, Clawdia Chauchat, deren Augen ihn an eine alte, homoerotische Liebe aus seiner Schulzeit erinnern. So ist er mehr als glücklich als der Chefarzt Dr. Behrens auch bei ihm eine Lungenerkrankung diagnostiziert, die ihn zwingt, seinen Aufenthalt auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Dies motiviert seinen letztlich siebenjährigen Aufenthalt auf dem Berghof, der unter der Hand zu einem Bildungsgang gerät. Erst der Ausbruch des Ersten Weltkriegs spült Castorp zusammen mit vielen anderen Insassen des Hotels wieder ins Flachland, wo der Erzähler seine Spur im Schlachtgetümmel verliert.
Was mich bei der ersten Begegnung mit diesem umfangreichen Buch fasziniert hat, war der Eindruck der erstaunlich ausgewogenen zeitlichen Beherrschtheit des Textes: Die Beschleunigung des Erzähltempos von der ausführlichen Schilderung der ersten Tage, Wochen und Monate bis zu dem unmerklichen Verfließen ganzer Jahre am Ende erschien mir so mühe- und bruchlos gestaltet, dass dieser Eindruck damals beinahe jede andere Wahrnehmung überlagerte. Dies hat sich bei der erneuten Lektüre nicht wieder im gleichen Maße eingestellt. Besonders im letzten Drittel empfand ich dieses Mal manche Passage als überdehnt und manches Motiv als zu breit ausgewalzt. So etwa die Auseinandersetzungen zwischen den beiden um die Menschwerdung Castorps ringenden Dämonen Settembrini und Naphtha, die Parodie auf die Mode der Geisterbeschwörung, die sich zugleich über die Psychoanalyse lustig macht, die Ausführungen zur Musik – das alles könnte auch kürzer und konziser gefasst werden und enthält viel Geschwätz, das einfach nur der Verarbeitung von eben angefallenem Stoff dient und weniger einer tatsächlichen Notwendigkeit des Erzählens entspringt.
Das ist aber nur die eine Seite; auf der anderen muss ich sagen, dass ich das Buch durchaus wieder mit großem Vergnügen gelesen habe. Wem es gelingt, den Text insgesamt als ein Spiel mit Motiven, Strömungen und Tendenzen seiner Zeit wahrzunehmen, der kann all dem mit vergnügter Distanz folgen. Das Verweben sowohl einer Bildungsroman- als auch einer Liebesroman-Parodie, die einander zudem auch noch erzählerisch bedingen, ist sehr fein und ungezwungen ausgeführt. Und nicht zuletzt habe ich auch den Genuss an Manns sprachlichem Manierismus wieder gefunden, der mir zwischenzeitlich verloren gegangen war. Natürlich kann es auch leicht geschehen, dass einem die letztlich gänzlich substanzlose Haltung des Erzählers auf die Nerven geht, aber mir ist es wenigstens diesmal gelungen, dass das Vergnügen an der Lektüre weit überwogen hat. Ich bin gespannt, wie meine Lesegeschichte mit Thomas Mann weitergehen wird …
Thomas Mann: Der Zauberberg. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2002. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 1103 Seiten. 42,– €. Zusammen mit dem umfangreichen Kommentarband: 84,– €. Der Text der GkFA erscheint im April 2012 erstmals auch im Taschenbuch.
P. S.: Vielleicht doch noch ein paar Worte zum Kommentarband: Mit gut 520 Seiten ist er fast halb so umfangreich wie der Text des Romans. Neben soliden Kapiteln zur Entstehung und Rezeption enthält er einen umfangreichen Einzelstellenkommentar, der in der Hauptsache den ungeheuer umfangreichen stofflichen Resonanzraum des Romans deutlich macht. Hier lassen sich schöne Funde machen, und es wird deutlich, was für ein außergewöhnlicher Organisator großer Stoffmengen Thomas Mann gewesen ist. Für die genießende Lektüre ist der Kommentar durchaus nicht notwendig, aber er hilft sehr beim Entdecken der hinter dem Gobelin verlaufenden Fäden.