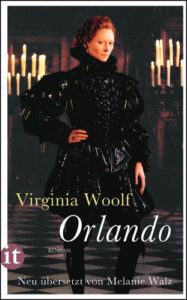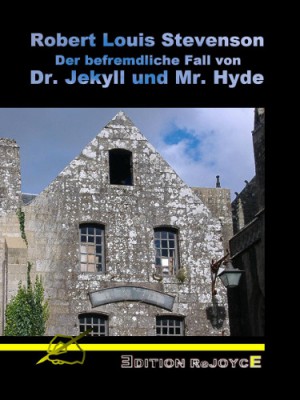Heiraten oder Hängen bleibt sich gleich.
 Auch eines der Stücke Shakespeares, mit denen sich die moderne Kritik schwer tut, endet es doch ausnahmsweise mit einer so unübersehbaren, platten und chauvinistischen Moral, dass es für den kritischen Menschen von heute das ganze Stück ruiniert. Da ist es doch einmal besser, kein Intellektueller zu sein und es so zu machen, wie das Publikum, das sich an der gut gemachten Komödie erfreut und Kätchens das Stück beschließende Predigt schlicht achselzuckend auf sich beruhen lässt. Denn gut gemacht ist das Stück:
Auch eines der Stücke Shakespeares, mit denen sich die moderne Kritik schwer tut, endet es doch ausnahmsweise mit einer so unübersehbaren, platten und chauvinistischen Moral, dass es für den kritischen Menschen von heute das ganze Stück ruiniert. Da ist es doch einmal besser, kein Intellektueller zu sein und es so zu machen, wie das Publikum, das sich an der gut gemachten Komödie erfreut und Kätchens das Stück beschließende Predigt schlicht achselzuckend auf sich beruhen lässt. Denn gut gemacht ist das Stück:
Shakespeare exzelliert hier in der Parallelführung zweier Handlungsstränge. Zum einen geht es um das Liebeswerben Lucentios um Bianca, zum anderen um die Erziehung ihrer eigensinnigen Schwester Katharina durch den ihr frisch angetrauten Petruchio. Lucentio ist ein junger Mann aus Pisa, der nach Padua zum Studium kommt. Gleich und auf Anhieb verliebt er sich aber in Bianca, die Tochter Baptistas, und um sie umschmeicheln zu können, lügt er sich als Lehrer verkleidet in Baptistas Haus. Baptista allerdings hat ein dringenderes Problem, als die liebliche Bianca an den Mann zu bringen: Biancas ältere Schwester Katharina ist als unverträgliche Zanknudel verschrieen. Um sie aus dem Haus zu bekommen, verhängt Baptista das Gebot, dass Bianca erst nach der Vermählung Katharinas an die Reihe komme.
Da trifft es sich gut, dass bei einem der Bewerber um Biancas Hand ein alter Freund eintrifft: Petruchio, gerade Erbe des väterlichen Reichtums geworden, sucht eine Frau zur Ergänzung seines Vermögens und Haushalts. Ihm ist nicht bange vor Katharina und ihren Launen und der Überzeugung, schon Schlimmeres durchgestanden zu haben als ein bisschen Zank. So wirbt er um Katharina bei ihrem Vater, teilt dann seiner Braut in spe in einem kurzen Wortgefecht seine Absichten mit und verabschiedet sich in Geschäften nach Venedig. Am nächsten Sonntag taucht er erst kurz vor der Trauung in einem unmöglichen Aufzug auf, lässt sich unter unmöglichem Benehmen trauen und verschwindet mit seiner Frau umgehend aus Padua.
Während nun in Padua für die Bewerber Biancas der Weg frei ist, wird uns im Hause Petruchios Katharinas Erziehung vorgeführt: Der Ehemann benimmt sich ärger als seine Frau es je könnte und traktiert sie gleichzeitig durch Essens- und Schlafentzug. Dies Spielchen treibt er solange, bis Katharina sich in die Machtverhältnisse fügt, zu allem Ja und Amen sagt und als die Klügere ihrem Ehemann, dem sie nun einmal ausgeliefert wurde, endlich nachgibt. Die letzte Probe liefert dann ein Fest, das zugleich drei Hochzeiten feiert: Die Katharinas und Petruchios, die Biancas und Lucentios und eine weitere, die der Symmetrie wegen benötigt wird. Hier führt Petruchio seinen Sieg über Katharina öffentlich vor, indem er – im Gegensatz zu den anderen Ehemännern – in der Lage ist, seiner Ehefrau geradewegs Befehle zu erteilen, ohne irgendeinen Widerstand bei ihr zu erregen. Das ganze gipfelt in eben jener schon erwähnten Moralpredigt Katahrinas über die Rolle der Ehefrau als gehorsame Untertanin und Dienerin ihres Ehemannes.
Man kann nun versuchen, mit diesem Schluss auf ganz verschiedene Weise fertig zu werden: Man kann ihn ironisieren – was nicht das Schlimmste ist, was die Tradition mit Shakespeares Stücken so getrieben hat –, man kann ihn kritisieren – was etwa auch der Übersetzer Frank Günther tut –, man kann ihn als dramaturgische Notwendigkeit begreifen – schließlich ist es die Aufgabe des Dramas, die Harmonie der Bühnengesellschaft wiederherzustellen – oder man kann ihn schlicht auf sich beruhen lassen – was klugerweise die meisten Zuschauer tun. Und doch ist es bemerkenswert, dass Shakespeare, dessen Stücke in den meisten Fällen von platten moralischen Belehrungen so angenehm frei sind, gerade dort, wo er einmal auf gut einer Seite die offizielle Moral seiner Zeit unverstellt zu Wort kommen lässt, uns gleich ganz und gar unmodern erscheint. Ob er überhaupt berühmt wäre, wenn er geschrieben hätte, was er wirklich dachte?
William Shakespeare: Der Widerspenstigen Zähmung. Übersetzt von Frank Günther. Zweisprachige Ausgabe. Gesamtausgabe Bd. 13. Cadolzburg: ars vivendi, 2002. Geprägter Leineneinband, Fadenheftung, zwei Lesebändchen, 304 Seiten. 33,– €.